|
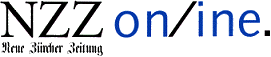
Feldpost von Bertelsmann:
Die Editionspraxis des Gütersloher Verlags im Dritten Reich
Von Siegfried Lokatis
Neue Zürcher Zeitung FEUILLETON Montag, 08.03.1999
Die Pflicht, der Reichsschrifttumskammer beizutreten,
zwang 1933 Autoren, Verleger, Drucker und Buchhändler im Deutschen Reich
unter nationalsozialistische Aufsicht. Anpassung schien lebensnotwendig,
aber wo wird sie zu geschmeidigem Mittun? Die Bertelsmann AG hat sich lange
eines sauberen Images erfreut. Besonders wichtig ist das für den
amerikanischen Markt, wo der Gütersloher Konzern durch den Erwerb von Random
House zum grössten Publikumsverlag aufgestiegen ist. Mittlerweile steht
Bertelsmanns Vergangenheit im Zwielicht - mit Grund, wie der nachstehende
Beitrag ausführt.
Die Bücher, mit denen Bertelsmann in die Kritik geraten ist,
tragen Titel wie «Panzer am Feind», «Volk im Schmiedefeuer», «Feuer
Marsch!» oder «45 000 Tonnen versenkt». Es handelt sich nicht um
«Ausrutscher» oder Bücher, die man «machen musste», sondern um eine gut
ausgebaute Produktlinie. «Mit Bomben und MGs über Polen» lag 1940 bei
110 000 Exemplaren, «Wir funken für Franco» ging 1941 in die 8. Auflage.
Besonders beliebt war das U-Boot-Segment. Der Verlag war um Aktualität
bemüht. 1940 erschienen etwa «Ein Sturzkampfflieger erlebt den
Polenkrieg», «Jagdgeschwader Schumacher räumt auf» und «Deutsche Flieger
gegen England».
Was die Hausautoren Paul Cölestin Ettighoffer und Werner von
Langsdorff (Künstlername: Thor Goote) - Bertelsmanns Antwort auf Ernst
Jünger und Werner Beumelburg - seit Anfang der dreissiger Jahre
betrieben, unterschied sich in nichts von dem, was die alliierten
Siegermächte später als «Kriegshetze» und «Vorbereitung des
Angriffskriegs» kennzeichnen sollten. Sie fabrizierten über ein Dutzend
dickleibiger Romane mit Titeln im Stuka-Staccato: «Flieger am Feind»,
«Flucht zur Front», «Glühender Tag». Es wäre müssig, näher auf den
Inhalt einzugehen. Die Briten zählten solche heute im Vergleich zu
manchen Computerspielen und RTL-2-Thrillern behäbig wirkenden
Kriegsbücher meist ohne viel Federlesens zur Gruppe I der
Verbotsliteratur, gemeinsam mit antisemitischen Hetzschriften und den
Pamphleten berüchtigter Naziführer und Kriegsverbrecher. Die von
Bertelsmann eingesetzte «unabhängige Untersuchungskommission» kann sich
auf die Frage konzentrieren, wie ein Verlag nach 1945 die Lizenz
erhielt, dessen Programm sich, überspitzt formuliert, zu gewichtigen
Teilen aus den «Listen der auszusondernden Literatur» rekonstruieren
lässt.
Für deutsche Verlage ging es nach dem Krieg nicht um den Ruf in
Übersee, sondern um die nackte Existenz. Entsprechend häufig wurden die
Fragebogen der Alliierten mit Lügen quittiert. Glücklich, wer aus einem
geringen Nonkonformismus eine Widerstandslegende zaubern konnte. Paul
Desch, vorher beim Gauverlag Bayerische Ostmark und einer der
erfolgreichsten Verleger der frühen Bundesrepublik, überzeugte
amerikanische Offiziere mit Hilfe eines Segelbootes und mit
Porzellangeschenken von seiner demokratischen Eignung. Bertelsmann
konnte auf seriöse Trümpfe verweisen. Im Land der Bischöfe Bodelschwingh
und Lilje war ein protestantisches Traditionsunternehmen mit Bindungen
zur «Bekennenden Kirche» an sich eine «grosse Nummer». Wer die
Verhältnisse kennt, wird dem Verlag wegen einzelner Entgleisungen im
Stil von «Deutscher Christus» oder «Dr. Martin Luthers kleiner
Katechismus für den braunen Mann» keinen Vorwurf machen. Der Titel
«Dennoch Altes Testament!» stand kurioserweise sowohl bei den Nazis als
auch bei den Engländern auf dem Index. Zahlreiche Titel wurden im
Dritten Reich verboten, der auf christliche Literatur spezialisierte
hauseigene Rufer-Verlag wurde 1943 komplett geschlossen.
Genau genommen war Bertelsmann seit 1939 kein konfessioneller
Verlag mehr. Von der Reichsschrifttumskammer vor die Wahl gestellt,
entweder konfessionelle Literatur oder Belletristik zu verbreiten (wie
dies auch anderen Verlagen mit weltlich-religiös «gemischter» Produktion
geschah), entschied sich Bertelsmann für die Preisgabe seiner über 100
Jahre alten christlichen Traditionslinie zugunsten des
Wehrmachtsgeschäftes. Die christliche Buchproduktion wurde in der
Nachkriegsphase für die Engländer noch einmal belebt, um nach Erlangung
der Lizenz alsbald auf ein Seitengleis geschoben zu werden.
Der zweite grosse Trumpf im Kampf um die Relizenzierung war das
Verbot des Verlages durch die Nationalsozialisten. Noch im Juni 1998
betonte der designierte Verlagschef Thomas Middelhoff gelegentlich einer
Preisverleihung in New York, dass Bertelsmann eine der wenigen
nichtjüdischen Medienfirmen gewesen sei, die während des Weltkriegs von
den Nazis geschlossen wurden. Dem widersprach im Oktober der
Düsseldorfer Soziologe Hersch Fischler in der «Weltwoche». Das durch
diesen Beitrag sowie zwei Sendungen des 3-sat-Fernsehmagazins
«Kulturzeit» erregte Aufsehen nötigte die Geschäftsführung in Gütersloh,
dem Vorwurf, die nationalsozialistische Vergangenheit werde vertuscht,
durch Einsetzung einer Untersuchungskommission um den angesehenen
Historiker Saul Friedländer zu begegnen. Das Problem, mit dem sich die
Kommission befassen wird, besteht nur auf den ersten Blick darin, dass
sich eine Verlagsschliessung bis jetzt nur für den Rufer-Verlag, nicht
jedoch für Bertelsmann nachweisen lässt. Die Dinge liegen hier
komplizierter, zumal auch geschlossene Verlage mit Einzelgenehmigungen
weiterproduzieren konnten.
Marktführer im Frontbuchhandel
Zunächst einmal: die Schliessungsaktion von 1943 betraf nicht
wenige, sondern wenigstens 1600 «nichtjüdische» Verlage, die für den
«totalen Krieg» überflüssig waren. Viel spricht dafür, dass auch
Bertelsmann zunächst «dichtgemacht» werden sollte. Angesichts der
unbestreitbaren Kriegswichtigkeit des Unternehmens handelte es sich
hierbei fraglos um eine politische Diskriminierung. Führende
Verlagsmitarbeiter wurden wegen illegaler Papiergeschäfte verhaftet,
auch hatte Bertelsmann den unverzeihlichen Fehler begangen, Eher, dem
Zentralverlag der NSDAP, Autoren abspenstig zu machen. Der Firmenname
wurde jedenfalls erst nachträglich handschriftlich auf die Liste der
kriegswichtigen Betriebe gesetzt.
Veranschlagt man die Langwierigkeit des Schliessungsverfahrens
und die Tatsache, dass seit Mitte 1944 im Prinzip ohnehin keine
Belletristik mehr verlegt werden durfte, geht es allenfalls um einen
Produktionsausfall von wenigen Monaten. Prinzipiell betrachtet taugt das
(reale oder geplante) Verbot schon deshalb nicht zum Heiligenschein,
weil die Gründe, die die Nazis dafür hatten, Bertelsmann eher peinlich
sein müssen. Firmenchef Heinrich Mohn war in den ideologischen
NS-Geschäften finanziell stark engagiert. Das ging so weit, dass ihn die
Nazis 1944 misstrauisch bezichtigten, «sich am totalen Krieg bereichert
zu haben». Doch DDR-Quellen, die dies nach dem Krieg überlieferten,
wurden in der westlichen Welt zu keiner Zeit ernst genommen.
Soeben ist im Verlag des Börsenvereins eine Studie über «Die
Wehrmachtsausgaben deutscher Verlage» erschienen, die die
Marktführerschaft Bertelsmanns im Frontbuchhandel mit Feldpostbändchen
belegt. Bertelsmanns Firmenhistoriker haben das Feldpostgeschäft als
Jugendsünde behandelt. 1942 aber waren 10 Millionen Reichsmark Umsatz
keine Kleinigkeit. Zu Recht bezeichnen die Verfasser der Studie die
Gesamtauflage von 19,5 Millionen Exemplaren (es waren eher mehr) als
«überraschend hoch und fast unglaubhaft». Die wichtigsten «bürgerlichen»
Konkurrenten, Insel und Reclam, brachten es auf Auflagen von kaum über
zwei Millionen. Bertelsmanns dominierende Position im Feldpostgeschäft
wurde nur vom NSDAP-Verlag Eher angefochten.
Die Gütersloher profitierten von der Okkupation. Sie nutzten die
«Möglichkeit der Auftragsverlagerung ins Ausland», nach Belgien,
Lettland, Litauen, Österreich, Rumänien und in die Tschechoslowakei.
Hans-Eugen Bühler und Klaus Kirbach, die Verfasser der Studie, führen
allein dreizehn Druckereien in den Niederlanden auf und deuten an, dass
man ihre Liste unschwer erweitern könnte. Mit Blick auf mögliche
Rückerstattungsansprüche hat Bertelsmann bereits klargestellt, keine
Zwangsarbeiter beschäftigt zu haben. Die - soweit es nicht gerade die
NS-Zeit betrifft - für einen Jubiläumsband erfreulich informative
Bertelsmann-Festschrift von 1985 hebt an den Feldpostheften
«Programmentscheidungen» mit einem «Haltungs-Akzent» hervor, welchem der
«braune Ungeist jener schweren Zeit nichts anhaben konnte». Dies sei ein
«Beleg für den Geschmack des Verlegers». Der «bewusst unpolitische
Charakter» der Hefte habe «dem nationalsozialistischen Regime
schliesslich einen Vorwand» geliefert, «die Verlagsarbeit des Hauses
Bertelsmann zu unterbinden». Unerwähnt bleibt leider, dass es sich bei
dem belobigten Programmsegment um die Umsetzung einer Anweisung des
Propagandaministeriums handelt: danach durften sich nämlich ohnehin nur
fünf Prozent der Feldpostbändchen mit weltanschaulichen Problemen
befassen. Was es mit dem «Haltungs-Akzent» auf sich hatte, wird
deutlich, wenn man Bertelsmanns Programmpolitik bis Anfang der fünfziger
Jahre, nach der erfolgreich absolvierten Lizenzierung, unter die Lupe
nimmt.
In der Sprache Daniel Goldhagens, mit dem sie heute auf der
Backlist des gleichen Verlagskonzerns stehen könnten, würden manche der
damaligen Bertelsmann-Autoren wohl als «willige Vorbereiter» gehandelt.
In den Fragebögen der Nachkriegszeit stellte man ihre christliche und
bürgerliche Gesinnung heraus. Hans-Friedrich Blunck, der Altpräsident
der Reichsschrifttumskammer, präsentierte sich 1946 den Engländern gar
als Repräsentant einer «niederdeutschen Demokratie». Den völkischen
Literaturpapst Will Vesper rechnet Bertelsmanns Festschrift der «inneren
Emigration» zu. In Vespers blutrünstiger Saga mit dem zweideutigen Titel
«Das harte Geschlecht» war zu lesen: «Vor Gott sind tausend Jahre wie
ein Tag.» Das Bibelzitat deutete man nachträglich als versteckte Kritik
am «Tausendjährigen Reich». Derlei ist zwar für die
Vergangenheitspolitik deutscher Verlage bezeichnend, aber abwegig, weil
das Buch bereits 1931 erschien.
Wie sich die Massstäbe verändert haben! Will Vesper, dessen sich
der Verlag heute schämt, schrieb vor seinem Wechsel zu Bertelsmann dem
Direktor von Langen-Müller: «Gewiss ist Bertelsmann ein gänzlich
unliterarischer Verlag, der in künstlerischen Dingen überhaupt kein
Gesicht hat. Aber dieses Gesicht kann er ja schliesslich bekommen.
Wenigstens muss ich mich so trösten, wenn Sie meine Bücher nicht
übernehmen können . . .» Bertelsmann stand im Ruf, anderen Verlagen die
Autoren «wegzufischen». Damit hängte sich der Verlag nolens volens an
die gültigen literarischen Trends. Das finanzielle Risiko dieser Methode
ist gering, nur darf man sich nicht wundern, wenn jetzt die
Ertragsbringer von einst wie Zeitbomben explodieren.
Ende der vierziger Jahre bereisten Bertelsmanns Aufkäufer
stillgelegte Konkurrenzverlage, um billig an die Kandidaten der
Arbeitsfrontbuchgemeinschaften für deren Hauptvorschlagsband zu
gelangen. Schon 1946 verhandelte Bertelsmann mit August Winnig, dem
Erfinder des Ausdrucks «Blut und Boden». Mit Hans-Friedrich Blunck, Will
Vesper und Hans Grimm, bodenständigen Dichtern, die sich um ihre Erbhöfe
sorgten, sowie mit den Werken des verstorbenen Paul Ernst war die
nationalsozialistische Preussische Akademie der Dichtung würdig
vertreten. Ihr ehemaliger Sekretär Paul Fechter hatte eine bereits 1932
skandalträchtige «volkhafte» deutsche Literaturgeschichte geschrieben,
deren Tendenz er in der berüchtigten Ausgabe von 1941 den Zeitumständen
gemäss zuspitzte. Die 1952 erschienene Fassung kann man in der
Bertelsmann-Festschrift auf Seite 330 betrachten.
Der Literaturspezialist der Reichsjugendführung, Friedrich
August Velmede, der als Repräsentant des «Kampfbunds für deutsche
Kultur» die ersten nationalsozialistischen Verbotslisten mit
ausgearbeitet hatte, gab in den frühen fünfziger Jahren im
Bertelsmann-Lesering die dreibändige Anthologie «Unvergängliches
Abendland» heraus. Hier war die alte Garde von Alverdes und Augustiny
bis Ziesel und Zillich fast komplett vertreten. Stefan Andres, Wolfgang
Borchardt und Ricarda Huch wirkten neben einstigen Nazigrössen wie Hans
Baumann, Rolf Italiaander, Wilhelm Pleyer und Heinz Steguweit wie blosse
Feigenblätter. Offenbar hat das Leben die literarische Einkaufspraxis
Bertelsmanns nicht bestraft. Das Programm einer Buchgemeinschaft steht
nicht im Scheinwerferlicht der literarischen Öffentlichkeit.
Cheflektor Wolfgang Strauss (vormals Reichsschule für den
deutschen Buchhandel) pflegte gern auf die Rolle seines Leserings bei
der Gewinnung neuer Leserschichten hinzuweisen. Dabei ging es zunächst
um die alten. Nicht leicht von der Hand zu weisen ist der Verdacht, die
«Königsidee Buchgemeinschaft» verdanke ihr Dasein weniger amerikanischen
Marketingkonzeptionen und der Büchergilde Gutenberg als den Erfahrungen
aus dem Frontbuchhandel und der «Deutschnationalen Hausbücherei» von
1916, der ersten Buchgemeinschaft der Welt.
Es kann hier nicht um Schuldzuweisungen gehen. Bertelsmann hat
sich inzwischen voll zu seiner historischen Verantwortung bekannt.
Notwendig ist die historische Rekonstruktion der produzierenden und
distributiven Strukturen literarischer Öffentlichkeit und politischer
Indoktrination im Dritten Reich, also eine Geschichte des gesamten
deutschen Verlagswesens und des Buchhandels. Antisemitismus und
nationalistischer Grössenwahn waren den Deutschen nicht angeboren,
sondern ideologische Phänomene, auf die die NS-Politik nicht ohne die
Hilfe von cleveren und «modernen» Marketingspezialisten in
konjunkturbewussten Verlagen hätte zurückgreifen können. Dort wurden
diese Ideologeme aufgenommen oder eigens gemacht, verstärkt und in
lukratives Schrifttum umgemünzt. Barbians Standardwerk beschreibt die
nationalsozialistische Literaturpolitik «von oben» her, jetzt geht es um
die ergänzenden Perspektiven von unten, um die Nachzeichnung eines von
Existenzangst, Anpassungselastizität, Orientierungslosigkeit und
Profitstreben gekennzeichneten Kräftespiels, das in seinen Auswirkungen
den öffentlichen Wertekonsens auf bedrückende Weise verschob.
Verlagsgeschichte bleibt Desiderat
Wir sprechen von weitgehend unerforschten Vertriebsstrukturen,
abseits der Höhenkamm-Literaturgeschichte. So fand sich 1987 in der
Gazette einer vergessenen Arbeitsfrontbuchgemeinschaft das
nationalsozialistische Frühwerk Luise Rinsers. Ein amerikanischer
Journalist recherchierte, dass Georg von Holtzbrinck (was meint
eigentlich «Die Zeit» dazu?) Startkapital und Know-how in den Grauzonen
des Vertriebs nationalsozialistischer Zeitschriften erworben hat. Auch
hat sich herausgestellt, dass der den Zwischenbuchhandel beherrschende
Kommissionär für Heydrich, den Leiter des gefürchteten
Sicherheitsdienstes (SD) der Nazis, die Verlagsproduktion seiner
Auftraggeber überwachte und, als Gegenleistung zum Importmonopol für
sowjetische Literatur, die Einrichtung eines SD-Lektorates anbot. Mit
Grund halten Verlage der Bundesrepublik noch immer ihre Archive
verschlossen.
Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verstrickung greift die
Einsetzung eines Bertelsmann- Untersuchungsausschusses zu kurz. Gewiss,
die amerikanische Öffentlichkeit ist nur mit grossen Namen zu
beeindrucken, und Unruhestifter Hersch Fischler hat auf diese Weise eine
Einrahmung erfahren. Der historischen Aufklärung indessen wäre
nachhaltiger mit der Einrichtung einer von den Grossen der Branche
gemeinsam getragenen Stiftung gedient, die die Förderung eines Instituts
für moderne Verlagsgeschichte zu ihrer Sache machte. Die Stiftung müsste
auch kleinere Verlage bei der so kostspieligen wie riskanten Pflege und
Öffnung ihrer Archive unterstützen. Wobei freilich die Forschung zu
beachten hätte, dass sie sich nicht auf Verlagsarchive fixieren darf. Im
Fall Bertelsmann beispielsweise harren Dutzende von
Autorenkorrespondenzen der Aufarbeitung, und dazu müssen die für private
Nachlässe einschlägigen Archive in Berlin, Hannover, London und Marbach
durchforstet werden. Ohne Sichtung der «Gegenüberlieferung», allein
gestützt auf die Bestände der Verlage, ergibt sich stets ein nur bedingt
aussagefähiges Bild.
Im Dritten Reich war Bertelsmann noch nicht Bertelsmann. Die
Führungsstellung in einem wichtigen Angebotssegment des
Wehrmachtsbuchhandels machte aus dem Haus noch keinen Giganten. Hans
Grimm verliess 1943 Langen- Müller, als der Verlag von der Arbeitsfront
an Eher verkauft wurde, weil er die anonym gesteuerten Verlagskonzerne
satt hatte. Deshalb ging er nach Gütersloh, wo Bertelsmann damals nicht
viel mehr als ein mittelgrosser, aufstrebender Provinzverlag war, der
sich am literaturpolitischen Konsens orientierte. Diese Orientierung
wirkt heute monströs, und dies um so mehr, betrachtet man die
Vergangenheit Bertelsmanns im Kontrast zu seinem jetzigen
liberal-demokratischen Auftreten, abgelöst vom Verlagsalltag unter den
historischen Bedingungen Nazideutschlands. Im Kontext einer bisher nur
in Ansätzen vorliegenden Geschichte des gesamten Verlagssystems wird
sich diese Monstrosität jedoch relativieren, ohne dass es beschönigender
Festschriften bedarf. Historische Gerechtigkeit kann es nur ohne
Verzerrungen geben. Bis zum nächsten Verlagsjubiläum bleiben elf Jahre
Zeit.
Siegfried Lokatis ist Verlagshistoriker am Zentrum für
Zeithistorische Forschung, Potsdam.
haGalil onLine -
Dienstag 23-03-99 |