|
Ein sozialdemokratisches
Widerstandskämpferschicksal:
Willy Scheinhardt
Gauleiter
des hannoverschen Fabrikarbeiterverbandes von 1925 bis 1933
Von ©Heide Kramer,
Hannover, Juni 2008

Stolperstein für Willy Scheinhardt
Foto: ©Stefan Schostok, Hannover, 3. März 2009
Herkunft und
Werdegang
Carl Willy Scheinhardt wird am 10. Januar 1892 als
Sohn eines Bergarbeiters in Etzdorf/Mansfelder Seekreis (Provinz
Sachsen) geboren. Nach Abschluss der Volksschule arbeitet er in
chemischen Fabriken als ungelernter Hilfsarbeiter. Er engagiert sich
früh politisch, tritt 1908 mit erst 16 Jahren in die Gewerkschaft
ein und 1910 auch in die SPD Bitterfeld, wo er sich als Leiter der
Arbeiterjugend profiliert. Im April 1919 nimmt er eine Stelle als
Sekretär des Fabrikarbeiterverbandes in Harburg an, der ihn im
November 1922 als Agitationsleiter nach Hannover beordert. Von 1925
bis 1933 ist Willy Scheinhardt in Hannover als Gauleiter des
Fabrikarbeiterverbandes tätig.
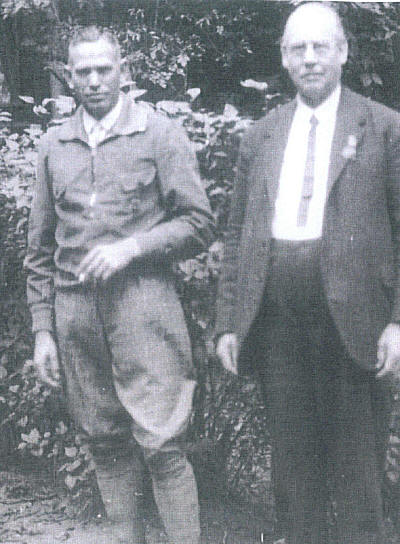
Willy Scheinhardt
(links) im Jahre 1931 mit Claas de Jonge, damaliger
Sekretär der Fabrikarbeiter-Internationale.
©Archivfoto IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover
Geschichtliches zum Deutschen Fabrikarbeiterverband
Vom 29. Juni bis 2. Juli 1880 findet in Hannover
mit Delegierten aus 28 Orten des Deutschen Reiches der "Kongress
aller nichtgewerblichen Arbeiter Deutschlands" statt. Es entsteht
eine neue Organisation, der "Verband der Fabrik-, Land- und
gewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands". Mit der Gründung des
Verbandes gelingt es allmählich, zersplitterte Lokalvereine von
ungelernten Arbeitern in einen festgefügten Zentralverband
einzubinden, um verbesserte Lohn- und Arbeitsbedingungen für die
Arbeiterschaft zu erreichen. Der Fabrikarbeiterverband will es
Arbeitern ohne Berufsausbildung ermöglichen, sich jeweiligen
Berufsorganisationen anzuschließen. Der erste Verbandsvorsitzende
des Fabrikarbeiterverbandes ist August Brey. Seine Amtszeit wird von
1880 bis 1931 dauern.
Die ersten Jahre nach seiner Gründung verlaufen für den Verband
krisenreich. Doch ab 1895 setzt trotz der Existenzbehinderungen
durch Unternehmer, Polizei und Justiz im wilhelminischen
Obrigkeitsstaat ein Aufschwung ein. Angesichts der unruhigen
gravierenden politischen Abläufe während des Ersten Weltkrieges, der
Nachkriegszeit, der Novemberrevolution 1918 und der politischen
Umbrüche erlebt der Verband ein Auf und Nieder. Doch gegen Ende der
Weimarer Zeit hat sich der Fabrikarbeiterverband zum viertgrößten
Verband der im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB)
zusammengeschlossenen Freien Gewerkschaften entwickelt. Damit
verliert er seinen Status als Verband der ungelernten Arbeiter.
Die neue Zentrale des Fabrikarbeiterverbandes in Hannover
wird im Februar 1930 als erstes eigenes Verbandsgebäude käuflich
erworben. Bis dahin hat in dem Haus eine Filiale der Berliner
Diskonto-Bank ihren Sitz. Der Umzug zum Rathenauplatz 3 vollzieht
sich im Juni 1930. Da der Verband aber auch am 28. Juni 1930 sein
40jähriges Dienstjubiläum begeht, bezieht er in die Feierlichkeiten
die Einweihung des neuen Verbandshauses mit dem Hauptsitz Am
Rathenauplatz 3 ein.

Das erste
eigene Verbandsgebäude des Fabrikarbeiterverbandes im
Hannoverschen Bankenviertel Am Rathenauplatz 3.
Foto: ©Walter Ballhause. ©Archiv IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover.
Während des
Festaktes in der Stadthalle Hannover sind zahlreiche namhafte
Gründungsmitglieder der ersten Stunde präsent, so August Brey,
dessen Name im engen Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte des
Fabrikarbeiterverbandes steht. Die "Deutsche Welle" überträgt die
charismatische Festrede Breys im Rundfunk. Anwesend sind ferner
August Lohrberg (Hannover), Claas de Jonge als Vertreter der
Fabrikarbeiter-Internationale, Heinrich Martens (Harburg) und Peter
Graßmann vom Gewerkschafts-Bundesvorstand.
Aus gegebenem Anlass hat der Vorstand des Fabrikarbeiterverbandes
bereits im Sommer 1929 beschlossen, einen Dokumentarfilm zur
Geschichte des Verbandes zu produzieren. Weil der hannoversche
Gauleiter Willy Scheinhardt den neuen Agitationsmethoden und den
zeitgemäßen Medien wie Film und Rundfunk aufgeschlossen und
fachkundig gegenüber steht, betraut ihn der Verband mit der
Projektleitung. In Kooperation mit dem Regisseur Albert Blum
entsteht der Film "Aufstieg", der eine positive Resonanz findet. Der
Dokumentarfilm geht in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verloren.
Willy Scheinhardt äußert sich dazu weitsichtig in einem Artikel:
"Ein
wichtiges Propagandamittel ist der Film. Wir verwenden ihn seit 4
Jahren. Unsere 4jährige Erfahrung reicht aus, um uns ein Urteil
bilden zu können. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass der
Film eins der wichtigsten Propagandamittel mit ist. Er wirkt
überzeugend und lockert den Boden ordentlich auf, der zu bearbeiten
ist. Die Filmpropaganda ist nicht, wie landläufig angenommen wird,
die teuerste, sondern sie ist die billigste. Die durchschnittliche
Besucherzahl unserer Filmveranstaltungen beträgt seit 4 Jahren
200. Mit Hilfe des Films tragen wir den gewerkschaftlichen Gedanken
in die Familien. Wir arbeiten nicht nur auf großen Hauptstraßen und
Märkten, wir gehen auch in die Quer- und Nebenstraßen, d. h. in das
kleinste Dorf. Heute wird allgemein ausgesprochen, dass die
Hausagitation in dieser Zeit das geeignetste Mittel ist, um zu
werben. Wir bestreiten das nicht. Wir sagen aber: Der Werber hat bei
der Hausagitation einen viel größeren Erfolg, wenn durch eine
großzügige Propaganda der Boden ordentlich aufgerissen ist, der zu
bearbeiten ist. – Werfen wir einen Blick in unsere Tages- und
Gewerkschaftszeitungen, so sehen wir, dass sie arm sind an Artikeln,
die sich mit dem Schicksal des Arbeiters, seinen Nöten und seinen
Sorgen beschäftigen. Hier war uns die alte Zeit überlegen".
(Auszugsweise
entnommen aus: "Ein Beitrag zur Frage der gewerkschaftlichen
Werbearbeit". Von ©W. Scheinhardt – Hannover – Gauleiter im
Fabrikarbeiterverband (mit der Schreibmaschine verfasster und
undatierter Artikel) ©
Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn,
2008.
Die neue
Zentrale stellt für den Fabrikarbeiterverband nicht allein ein
äußeres Zeichen von Erfolg und Aufstieg dar, sie bietet außerdem
unübersehbare bessere Arbeitsbedingungen für die einzelnen
Abteilungen des Hauptvorstandes .
Durch Um- und Ausbaumaßnahmen im Gebäude Am Rathenauplatz 3 entsteht
eine weitere Etage mit Wohnraum für die Verbandsangehörigen und ihre
Familien. Der Gauleiter Willy Scheinhardt, seine Ehefrau Emma
(geborene Gerig), die am 14. Oktober 1924 geborene Tochter Gerda,
der Reichstagsabgeordnete und Sekretär der Tarifabteilung Richard
Partzsch
sowie der Hausmeister Willi Krahtz ziehen ein.
Durch die Machtübernahme Hitlers im Januar 1933
häufen sich bald die bedrohlichen politischen Ereignisse, die sich
durch spürbare Repressalien in Form von Aus- und Gleichschaltung und
Ermordung der vermeintlichen Gegner aller Richtungen äußern.
Einbezogen sind Gewerkschaften und Verbände. Bereits im Februar 1933
finden in Hannover Aufmärsche der Nazis anlässlich Hitlers Ernennung
zum Reichskanzler statt.
Der 1. April 1933
ist der Tag des Boykotts jüdischer Geschäfte in
Deutschland. Die Nazis besetzen in Hannover die Gewerkschaftshäuser
und verhaften Gewerkschafter und Angestellte. Auch der Gauleiter
Willy Scheinhardt wird von der SS verhaftet. Im Gegensatz zu seinen
Kollegen bleibt er länger im Gefängnis und kommt erst später wieder
frei.
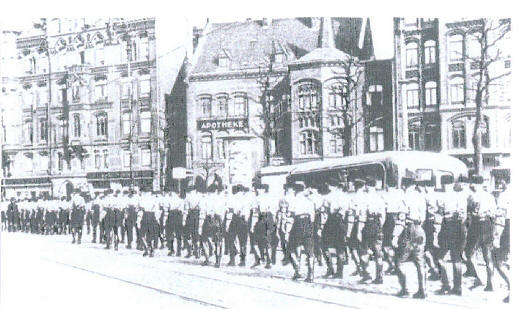
Aufmarsch der SA in Hannover am Klagesmarkt.
Foto: ©Walter Ballhause. ©Archiv IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover.
Die SA dringt
in das Verbandsgebäude am Rathenauplatz ein, beschlagnahmt
Verbandseigentum und -vermögen, versiegelt die Räume und hisst auf
dem Dach die
Hakenkreuzfahne. Die im Haus der Hauptverwaltung ansässigen Familien Scheinhardt und Partzsch dürfen nur mit (von der SA-Hilfspolizei
ausgestellten) "Erlaubnisscheinen" ihre eigenen Wohnungen betreten
und verlassen.
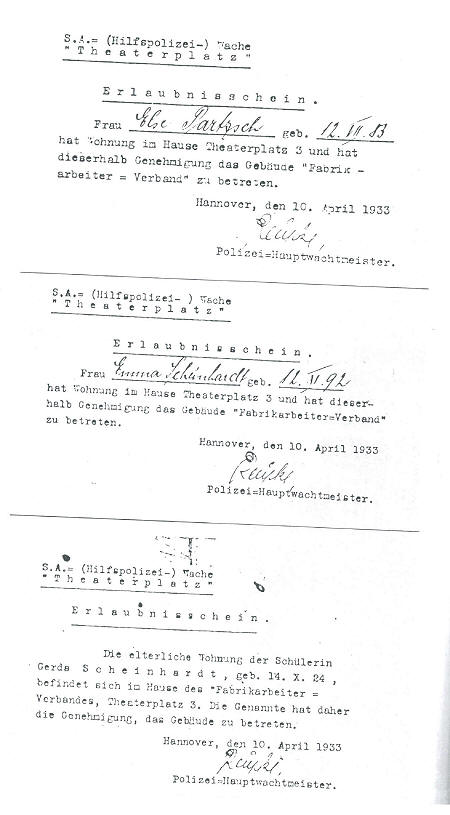
Die im Haus der Hauptverwaltung
ansässigen Familien Scheinhardt und Partzsch
dürfen nur mit (von der
SA-Hilfspolizei ausgestellten) "Erlaubnisscheinen" ihre
eigenen
Wohnungen betreten und verlassen.
©Publikation:
"1. April 1933 –
50 Jahre danach". Herausgeberin: IG
Chemie-Papier-Keramik, 1983 (Archiv)
Die
Bewohner werden aus dem Haus vertrieben. Familie Scheinhardt zieht
in die Rodenstr. 9 (Hannover-Linden) und lebt ab 1935 in der
Hagenstr. 58 (Hannover-List). Mitte April 1933 ist die Zentrale
wieder zugänglich und benutzbar. Der Fabrikarbeiterverband hat
jedoch bereits am 1. April 1933 seine Eigenständigkeit verloren. Der
materielle Verlust nach dem begangenen Überfall bringt den schwer
geschädigten Gewerkschaftsangehörigen Existenzkrisen. Davon
betroffen ist auch die Familie Scheinhardt, die wie die anderen
Genossen aus der Not heraus nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten
sucht.
Das
Ehepaar Scheinhardt steigt in einen Wäscheverkauf ein, um u. a.
Kontakt zu ehemaligen Genossen zu halten. Frau Emma führt das
Geschäft nach Verhaftung und Ermordung ihres Mannes bis 1938 allein
weiter. Weil die geringe Rente zum Leben für sie und ihre Tochter
Gerda nicht ausreicht, arbeitet Frau Emma Scheinhardt außerdem als
Aushilfe in einer Gastwirtschaft bei Bekannten.
Politische Aktivitäten
und Widerstand gegen die Faschisten
Verhaftung, Deportation und
Ermordung Willy Scheinhardts
Noch 1936 hält er den Kontakt mit weiteren
SPD-Genossen aufrecht. Sie betreiben u. a. gemeinsam ein Wanderkino,
das jedoch unter die Zensur der Nazis fällt und verboten wird.
Im Januar 1936 zerschlägt die Gestapo die
Widerstandsorganisation "Sozialistische Front" und verhaftet dabei
auch Willy Scheinhardt in Hannover. Im Gestapogefängnis Hildesheim
bleibt er unter dem Vorwurf des Hochverrats in Haft. Am 6. Oktober
1936 stirbt er an den Folgen grausamer Folterungen durch die
Gestapo.
Der "Neue
Vorwärts" berichtet am 8. November 1936 in seiner Nr. 178:
"Der frühere Gauleiter des Deutschen
Fabrikarbeiterverbandes, der Genosse Willy Scheinhardt, ist Anfang
Oktober den Misshandlungen durch die Gestapo erlegen und am 14.
Oktober in aller Stille eingeäschert worden. Der Genosse Willy Scheinhardt, der jetzt im Alter von 44 Jahren einen so
grausamen Tod erleiden musste, hat von früher Jugend an als
Sozialdemokrat und Gewerkschafter selbstlos der Gesamtbewegung und
ihren Zielen
gedient; er ist auch nach Hitlers Machtantritt seiner
sozialistischen Überzeugung treu geblieben und musste nun seine
Treue zu unseren Ideen mit dem Leben büßen.--
Der
Generalstaatsanwalt dokumentierte am 17. Oktober 1936, dass er
zwischen dem 29.9. und 6.10.1936 zu Tode geprügelt worden ist, weil
er "vermutlich kein vollständiges Geständnis abgelegt hat.""
Die Gestapo verweigert den
Familienangehörigen zunächst die offizielle Freigabe des Leichnams.
Die Urnenbeisetzung erfolgt am 14. Oktober 1936 auf dem Friedhof
Hannover-Ricklingen. Es ist der 12. Geburtstag seiner Tochter Gerda.
Das Grab wurde
inzwischen eingeebnet.
Das Schicksal der Familie nach der
Ermordung Willy Scheinhardts
Nach 1944 wird
Frau Scheinhardt ausgebombt und kommt mit ihrer Tochter Gerda bei
Bekannten in Ricklingen unter. Später bewohnen beide bis zu ihrem
Umzug nach Hannover-Ricklingen in ihr eigenes Haus im Jahre 1952
zwei Zimmer in Hannover-Waldhausen.
Frau Emma Scheinhardt stirbt am 7. September 1984 im Alter von 92
Jahren in Hannover. Gerda Scheinhardt heiratet am 13. Oktober 1951
Alfred Sauthof.

Hochzeit 1951:
Unten von links: Gerdas Nichten Sigrid und Uta Haupt.
Mittig von links: Gerda (geb. Scheinhardt) und Alfred Sauthof.
Oben von links: Emma Scheinhardt, daneben unbek. Person.
>>
Willy Scheinhardt:
Warum neue Formen in der gewerkschaftlichen
Agitation?
Quellen:
©Gerda Sauthof,
geb.
Scheinhardt, Hannover, 2008. Verstorben im März 2013.
©Doris Nolle, geb. Sauthof, 2008. Verstorben Anfang 2012.
©Uta
Paletta, Sarstedt, 2008.
©VVN-BdA,Hannover, 2008.
©Publikation: "1890 – 1990: 100 Jahre Industriegewerkschaft
Chemie-Papier-Keramik". Herausgeber: Hauptvorstand der IG
Chemie-Papier-Keramik, Bund Verlag, Hannover, 1990. Der Publikation
entnommenes Bildmaterial: ©Archiv IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover
(mit zwei Fotos von ©Walter Ballhause).
©Publikation:
"1. April 1933 – 50 Jahre danach". Herausgeberin: IG
Chemie-Papier-Keramik, 1983.
©Gerda Zorn:
"Widerstand in Hannover. Gegen Reaktion und Faschismus 1920 – 1946",
Röderberg-Verlag, Frankfurt am Main. Bibliothek des Widerstandes,
1977.
©Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn,
2008.
©Auszug aus
Wikipedia, 2008.
©Stadtarchiv Hannover, Am Bokemale 14 – 16, 2009.
©"Hallo Wochenblatt" (Hannoversches Wochenblatt) vom 25. Febr. 2009.
©Das Hochzeitsfoto von Gerda und Alfred Sauthof aus dem Jahre 1951
wurde freundlicherweise von Frau Uta Paletta, geb. Haupt, zur
Verfügung gestellt.
Mein Dank
richtet sich an:
Posthum an Gerda Sauthof,
geborene Scheinhardt. Sie war die in Hannover lebende Tochter Willy Scheinhardts.
Posthum an Doris Nolle. Sie war die Tochter von Gerda Sauthof.
Uta Paletta,
die mir den Kontakt mit ihrer Tante Gerda Sauthof ermöglichte.
Birgit Hormann,
IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover.
VVN-BdA
Hannover, Jürgen Stiewe und H. D. (Charly) Braun, VVN-BdA Hannover
und DGB, Hannover.
©Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn.
©Stefan Schostok, Kurt-Schumacher-Haus Hannover, für das zur
Verfügung gestellte Fotomaterial. März 2009.
Anmerkungen:
Um 1910 wird das Gebäude für das Bankhaus Bartels errichtet
(Architekt: Friedrich Geb). Es erfolgt bald darauf der Umbau der
Dachzone mit Erweiterung des Fassadenschmucks von Oswald Rommel. Im
Februar 1930 erwirbt der Fabrikarbeiterverband das Haus als erstes
eigenes Verbandsgebäude. Bis dahin befindet sich hier eine Filiale
der Berliner Diskonto-Bank. Nach 1945 wird das Haus zum Sitz der IG
Chemie (Nachfolge des Fabrikarbeiterverbandes), heute Niederlassung
der SEB (Bank).
Richard Partzsch
(geboren am
15.11.1881 in Dresden, gestorben am 6.11.1953 in Hannover) Er
wird nach der Schule Dekorationsmaler. Seit 1902 ist er Mitglied
der SPD und Gewerkschaft. Dann einige Jahre vor dem Ersten
Weltkrieg Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Dresden-Cotta. Ab
1913 Geschäftsführer des freigewerkschaftlichen
Fabrikarbeiterverbandes in Köslin. Zwischen 1919 und 1922
Stadtverordneter und Mitglied des Deutschen Reichstages in
Köslin. Während dieser Zeit ist Partzsch Mitglied des
Provinziallandtages von Pommern. Im März 1920 außerdem
Zivilkommissar in Köslin, zwischen 1919 und 1922 in Köslin
ebenfalls Stadtverordneter, 1920 für einige Monate erstmals
Mitglied des Reichstages. Ab 1922 lebt er in Hannover, wirkt
dort seit 1933 als Gewerkschaftssekretär im Hauptvorstand des
Verbandes der Fabrikarbeiter Deutschlands. 1932/33 erneut
Mitglied des Deutschen Reichstages, ab 1933 Angehöriger der
lokalen Widerstandsgruppe der Sozialistischen Front. Partzsch
wird 1936 von der Gestapo in Hannover verhaftet und erst 1937
freigelassen. 1944 erfolgt eine erneute Verhaftung im Rahmen der
Aktion Gewitter. Von 1945 bis zu seinem Ausscheiden ist
Richard Parztsch im Büro Dr. Kurt Schumacher tätig und Mitglied
im Vorstand der SPD. ©Wikipeda
Beitrag
von ©Willy Scheinhardt, Hannover, September 1931 (Der Artikel ist
von Willy Scheinhardt mit der Schreibmaschine verfasst und hier
vollständig wiedergegeben worden):
"Warum neue Formen In der gewerkschaftlichen Agitation?"
©
Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn,
2008.
Ein Stolperstein für Willy
Scheinhardt

Foto: ©Stefan Schostok, Hannover, 3. März 2009.
Am 3. März 2009 wurde um 10.30 Uhr die
Stolpersteinverlegung für Willy Scheinhardt vor dem ehemaligen
Verbandsgebäude des Fabrikarbeiterverbandes im Hannoverschen
Bankenviertel Am Rathenauplatz 3 (heute: An der Börse 3) vollzogen.

Im ehemaligen ersten eigenen Verbandsgebäude des
Fabrikarbeiterverbandes im Hannoverschen Bankenviertel Am
Rathenauplatz 3 befindet sich heute eine Bankniederlassung mit der Adresse An der Börse 3.
Foto: ©Heide Kramer, 3. März 2009.
"Die Karawane der Erinnerung" bestand aus dem
Künstler Gunter Demnig, Mitarbeitern des Stadtarchivs, des
Fachbereichs Bildung und Qualifizierung, den beim Verlegen des
Stolpersteins unterstützenden Mitarbeitern des Tiefbauamtes,
Vertretern von Organisationen und Verbänden und aus Teilnahme
bekundenden Bürgern.
Uta Paletta war als Großnichte des Opfers eingetroffen.

Der Künstler Gunter Demnig lässt es sich nicht nehmen, jeden Stein
persönlich zu verlegen.
Foto: ©Stefan Schostok, Hannover, 3. März 2009.
Die Inschrift des Stolpersteins lautet:
HIER ARBEITETE
WILLY SCHEINHARDT
JG. 1892
VERHAFTET JAN. 1936
Gestapogefängnis
Hildesheim
GEFOLTERT
TOT 6.10.1936
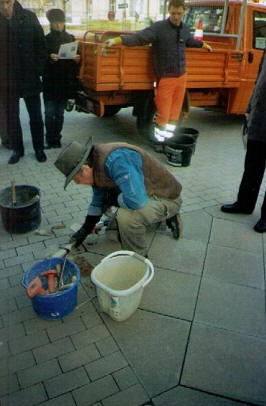
Der Künstler Gunter Demnig beim Verlegen des Stolpersteins
für Willy Scheinhardt.
Foto: ©Heide Kramer,Hannover, 3. März 2009.
©Heide Kramer, Hannover, Juni 2008. Aktualisiert:
April 2013.
|