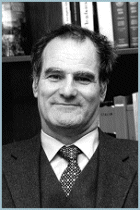 Mit
dem Ende der NS-Herrschaft im Mai 1945 schien auch die jüdische Geschichte
in Deutschland definitiv beendet. Aber bereits 1945/46 kam es in mehr als 60
Städten Ost- und Westdeutschlands zur Neugründung jüdischer Gemeinden.
Mit
dem Ende der NS-Herrschaft im Mai 1945 schien auch die jüdische Geschichte
in Deutschland definitiv beendet. Aber bereits 1945/46 kam es in mehr als 60
Städten Ost- und Westdeutschlands zur Neugründung jüdischer Gemeinden.
Deutschland nach 1945:
Geschichte der jüdischen Gemeinden
Leben im Land der Täter. Mit der Geschichte der
jüdischen Gemeinden in Deutschland nach 1945 beschäftigt sich der zweite
thematische Teil eines Sammelbands, der auf eine Tagung des Moses
Mendelssohn Zentrums in Potsdam zurückgeht, herausgegeben von
Professor Dr.
Julius H. Schoeps.
Juliane Wetzel schildert das
jüdische Leben in
München, wo
die Neugründung der Gemeinde kaum mehr etwas mit der alten Tradition des
deutschen Judentums zu tun hatte. Denn wie Berlin war auch München ein
Zufluchtsort für zahlreiche jüdische Flüchtlinge vor den polnischen Pogromen
1946.
Zwischen den Juden osteuropäischer Herkunft
mit ihren mehrheitlich orthodoxen Traditionen und den deutschen
assimilierten Juden kam es in der Gemeinde in München zu erheblichen
Spannungen.
Ina Lorenz berichtet über die Wiederanfänge der Jüdischen Gemeinde in
Hamburg. Dort organisierten sich im Sommer 1945 die überlebenden Juden in
mehreren miteinander konkurrierenden Vereinigungen, um sich dann aber in
wenigen Jahren als "Einheitsgemeinde" zu stabilisieren. Die Gemeindeglieder
sahen sich von Beginn an in der Tradition der alten Gemeinde und verstanden
sich als "Aufbaugemeinde", nicht aber als sog. "Liquidationsgemeinde". Da in
Hamburg nur ein verhältnismäßig geringer Anteil von sog. "Ostjuden" und DPs
lebte, kam es hier weniger als in anderen Gemeinden zu Konflikten zwischen
verschiedenen Traditionen. Auch begegneten die politisch Verantwortlichen in
Hamburg der Gemeinde weitgehend mit wohlwollender Aufmerksamkeit und Hilfe.
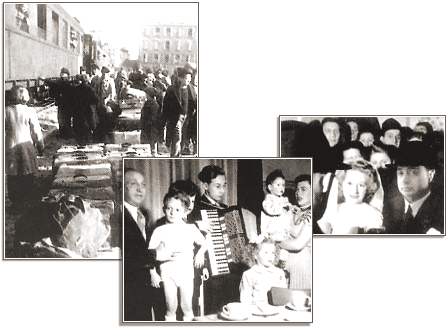
Die besondere politische Situation der Stadt Berlin spiegelt sich auch in
der Berliner Jüdischen Gemeinde wider, wie Ulrike Offenberg in ihrem
Beitrag darlegt. Zunächst bildeten sich selbständige Gemeindeinitiativen
heraus, die im Oktober 1945 eine gemeinsame Gemeindeleitung wählten. Die
während der sieben Jahre seit Kriegsende mühsam aufgebaute Einheitsgemeinde
spaltete sich, als die antisemitische Politik der SED im Gefolge des
Slansky-Prozesses eine Fluchtwelle von Juden aus der DDR und Ostberlin
auslöste. Während sich die "Jüdische Gemeinde zu Berlin" im Westteil der
Stadt für die Aufnahme der Flüchtlinge einsetzte und sich fortan offen
antisowjetisch positionierte, wurde im Ostteil unter massiver Einflussnahme
der SED die "Jüdische Gemeinde von Groß-Berlin" gegründet.
Das jüdische Leben in Franken am Beispiel der Gemeinde von Fürth erlebte in
der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Art Renaissance, in der, trotz
verschiedener innergemeindlicher Konflikte, nicht nur eine organisatorische,
sondern auch eine religiöse Wiederbelebung weitgehend erfolgreich verlief,
wie Monika Berthold-Hilpert aufzeigt.
Die Geschichte der
Jüdischen Gemeinden in der SBZ/DDR bis 1952/53 beleuchtet
Lothar Mertens. Er geht dabei insbesondere auf die Beziehung der
Gemeinden zur SED ein. Aus seiner Sicht war bereits die Unterscheidung
zwischen — aktiven — Kämpfern gegen den Faschismus und — passiven — Opfern
des Faschismus Zeichen eines fortbestehenden Antisemitismus.
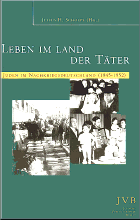
Julius H. Schoeps (Hg.)
Leben im
Land der Täter
Jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland (1945-1952)
Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek 4, Pb., ca. 320 Seiten, Format: 14,5 x
22 cm, Preis Euro[D] 34,-, ISBN 3-934658-17-2
Mit Beiträgen von Werner Bergmann, Y. Michael Bodemann, Josef Foschepoth,
Angelika Königseder, Wolfgang Kraushaar, Ina S. Lorenz, Lothar Mertens,
Ulrike Offenberg, Julius H. Schoeps, Juliane Wetzel, u.a...