|
Eindrücke von einem Besuch am Mahnmal:
Ein neuer Spielplatz für Berlin?
Seit zwei Wochen ist das Berliner
Denkmal für die ermordeten Juden Europas für die Öffentlichkeit zugänglich.
Von Franziska Werners
Zuerst gab es die offizielle Eröffnung mit geladenen
Gästen und ernsten Ansprachen. Wenn man von Frau Roshs Ausrutscher bezüglich
der Beerdigung eines gelben Sterns und des Zahns eines Opfers absieht, alles
in allem ein durchaus seriöser Akt, dem jedoch sehr bald weniger erfreuliche
Szenen folgen sollten. Die Bilder, die unmittelbar nach der Öffnung
des Berliner Holocaust-Denkmals durch die Presse gingen, berührten
unangenehm: Jugendliche sprangen scheinbar gänzlich unbefangen von Stele zu
Stele und verwandelten das Denkmal in einen Spielplatz.
Am verlängerten Pfingstwochenende wurde es besonders bunt.
Neben den üblichen Hauptstadtattraktionen lockte der Karneval der Kulturen
zur Multi-Kulti Parade nach Kreuzberg, das internationale Turnfest hatte
zahllose Sportler und Vereine aus Deutschland und Europa geladen und
irgendwie lag es für viele Besucher wohl nahe, auch dem Holocaust Denkmal
einen Besuch abzustatten, zumal an einem so sonnig-warmen Frühlingstag.
Das Bild das ich zuvor etwas ungläubig in der Zeitung
gesehen und für eine Ausnahme gehalten hatte, bot sich nun gleich
dutzendfach.

Unbeeindruckt von Fernsehteams oder Pressefotografen
liefen (nicht nur) jugendliche Besucherinnen und Besucher fröhlich lärmend
über die Stelen, halfen sich gegenseitig beim Aufstieg auf höhere Steine und
hatten sichtlich Vergnügen an ihrer sportlichen Betätigung.

Die Besucherordnung, die derartiges Benehmen ausdrücklich
untersagt, wurde als Inschrift auf einer etwa 50 mal 50 Zentimeter großen
Platte an den vier Ecken des Denkmals in den Boden eingelassen. Welch
wunderbare Ironie: eine Besucherordnung, die man mit Füßen treten kann.
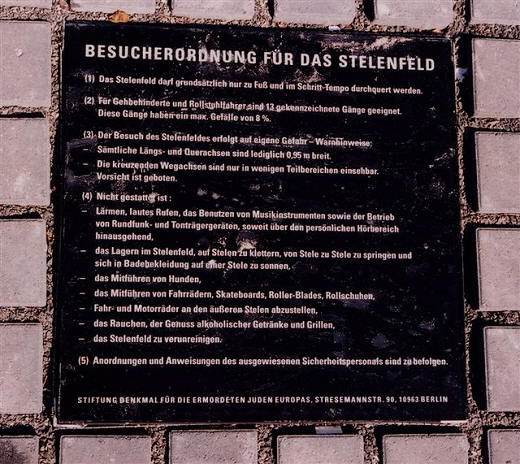
Besucherordnung für das Stelenfeld
(1) Das Stelenfeld darf grundsätzlich nur zu Fuß und im Schritt-Tempo
durchquert werden.
(2) Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer sind 13 gekennzeichnete Gänge
geeignet. Diese Gänge haben ein max. Gefälle von 8 %.
(3) Der Besuch des Stelenfeldes erfolgt auf eigene Gefahr – Warnhinweise: –
Sämtliche Längs- und Querachsen sind lediglich 0,95 m breit. – Die
kreuzenden Wegachsen sind nur in wenigen Teilbereichen einsehbar. Vorsicht
ist geboten.
(4) Nicht gestattet ist : – Lärmen, lautes Rufen, das Benutzen von
Musikinstrumenten sowie der Betrieb von Rundfunk- und Tonträgergeräten,
soweit über den persönlichen Hörbereich hinausgehend, – das Lagern im
Stelenfeld, auf Stelen zu klettern, von Stele zu Stele zu springen und sich
in Badebekleidung auf einer Stele zu sonnen, – das Mitführen von Hunden, –
das Mitführen von Fahrrädern, Skateboards, Roller-Blades, Rollschuhen, –
Fahr- und Motorräder an den äußeren Stelen abzustellen, – das Rauchen, der
Genuss alkoholischer Getränke und Grillen, – das Stelenfeld zu
verunreinigen.
(5) Anordnungen und Anweisungen des ausgewiesenen Sicherheitspersonals sind
zu befolgen.
Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Stresemannstr. 90, 10963
Berlin
Fast genauso dezent verhielten sich die zahlenmäßig
allerdings weit unterlegenen Sicherheitsbeamten. Sie durften nicht verraten,
wie viele tatsächlich im Einsatz waren, aber auf die Frage ob die eigene
Zählung von vier der Realität nahe käme, wurde schließlich doch bestätigend
genickt. Freilich, man kann nicht neben jede Stele einen Aufpasser stellen,
wie einer der Besucher in breitem schwäbisch anmerkte, aber vielleicht
dürften es doch ein paar mehr sein als einer pro Ecke, zumal an einem
solchen Tag. Auch wäre diesen Beamten etwas mehr von Lea Roshs
Sendungsbewußtsein zu wünschen, dann würden sie den Denkmal-Turnern,
Rauchern und Hundebesitzern, die ihren Vierbeiner partout mit sich ziehen
müssen, gewiß energischer entgegengetreten.
Die da so leichtfüßig über das Denkmal und seine
Besucherordnung sprangen, waren übrigens keineswegs nur Jugendliche, wie
auch die, die sich über derartiges Benehmen aufregten, nicht allesamt der
Generation der Alt 68er und älter angehörten. "Das mußt Du Dir vorstellen,
das sind Erwachsene und die turnen da rum wie auf dem Spielplatz, als wäre
das einfach nur ein total geiles Event", empört sich eine Frau Anfang 20.
Der junge Mann neben ihr verzieht ebenfalls angewidert das Gesicht und
schüttelt den Kopf.
An anderer Stelle werden Familienfotos gemacht: Zwei Väter rücken ihre zwei-
bis dreijährigen Kinder auf einer Stele zurecht. Die eine Mutter
fotografiert, die zweite macht hinter der Kamera Faxen, um den Nachwuchs in
Stimmung zu bringen.
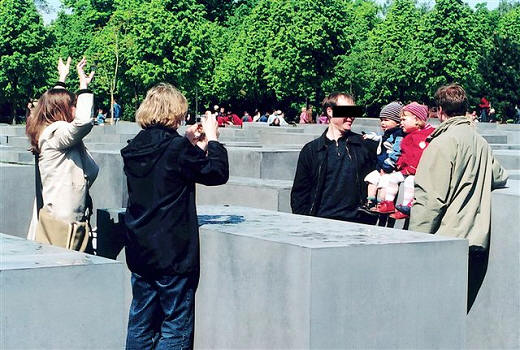
Es sind sicher bezaubernde Fotos geworden, aber ob die
lieben Kleinen in etwa 15 Jahren beim Betrachten dieser Schnappschüsse nicht
doch ein paar Beklemmungen haben werden? Ob sie ihre Eltern dann vielleicht
einmal fragen, warum, wo doch der Tiergarten so nahe lag, sie ausgerechnet
das Denkmal für die ermordeten Juden Europas zur Kulisse für dieses nette
Familienfoto gewählt haben?
Es gibt auch ganz andere Fotos und die hängen nur wenige
Meter entfernt, unter dem Stelenfeld im Ort der Information. Im "Raum der
Familien" werden unter Verwendung großformatiger Reproduktionen von
Familienfotos 15 Lebensläufe jüdischer Familien in Europa vorgestellt, die
Umstände des Lebens, Überlebens und Sterbens jedes einzelnen
Familienmitglieds - soweit bekannt - vor, während und nach der Shoah. Im
"Raum der Dimensionen" finden sich Textauszüge aus Postkarten, Tagebüchern
und Notizen, die jüdische Frauen und Männer auf der Flucht oder vor ihrer
Deportation zurückließen oder noch versucht hatten, an Freunde und
Angehörige zu schicken - bedrückende Zeugnisse von Todesangst und
Verzweiflung.
Auch die anderen übersichtlich angeordneten
Dokumentationen, der "Raum der Namen", der "Raum der Orte", das
Gedenkstättenportal und nicht zuletzt die Namensdatenbank mit den
Gedenkblättern aus Yad Vashem verfehlen ihre Wirkung nicht: Im Vergleich zum
Rummel auf dem Stelenfeld herrscht in den leicht abgedunkelten
Dokumentationsräumen relative Stille. Die Stimmen der Besucher sind
gedämpft, und viele von ihnen hatten zuvor mehr als zwei Stunden in der
Schlange gestanden, um diese Ausstellung zu sehen.

Wer am Pfingstwochenende den Ort der Information unter
dem Stelenfeld besuchen wollte, nahm lange Wartezeiten in Kauf.
Im Gästebuch finden sich Einträge, in denen von Scham und
Trauer zu lesen ist, aber auch von Entschlossenheit, so etwas nie wieder
geschehen zu lassen. Was hier auf vergleichsweise wenigen Quadratmetern zu
sehen und zu hören ist, erhebt nicht den Anspruch, etwas gänzlich neues oder
eine historische Gesamtdarstellung des Holocausts und seiner Ursachen zu
bieten, und scheint doch dem ursprünglichen Ziel der Initiatoren Lea Rosh
und Eberhard Jäckel, nämlich ein Denkmal zu setzen, also einen zentralen Ort
zu initiieren, an dem der Ermordung der europäischen Juden gedacht werden
soll, näher zu kommen als Peter Eisenmans architektonisches Event.
Andererseits, ob ohne das Event überhaupt so viele Menschen den Weg in diese
Dokumentationsräume gefunden hätten?
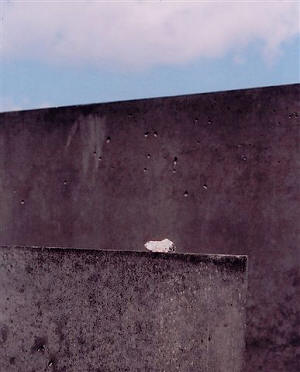 Und
selbst draußen finden sich durchaus auch andere, stillere Besucherinnen und
Besucher, die innehalten oder Blumen auf einer der Stelen ablegen oder auch
einen Stein, wie es auf jüdischen Friedhöfen üblich ist. Und
selbst draußen finden sich durchaus auch andere, stillere Besucherinnen und
Besucher, die innehalten oder Blumen auf einer der Stelen ablegen oder auch
einen Stein, wie es auf jüdischen Friedhöfen üblich ist.
Und es gibt die engagierten Hauptschullehrerinnen, die
sich nach dem Besuch mit ihrer Klasse nicht nur freuen, weil sich alle gut
benommen haben, sondern auch darüber, daß ihre Schülerinnen und Schüler
tatsächlich ernsthaft und mit großer Aufmerksamkeit dabei waren . "Wir haben
die Kinder aber auch entsprechend vorbereitet auf diesen Tag" erklärt eine
der Pädagoginnen. Wie schön, wenn dieses Beispiel Schule machen würde -
nicht nur bei Kindern ...
Alle Fotos © Franziska
Werners

Denkmäler in Berlin
hagalil.com 26-05-2005 |