|
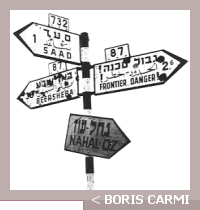 Entwurzelung,
Flucht, Vertreibung, Neuanfang: Entwurzelung,
Flucht, Vertreibung, Neuanfang:
Fotografien von Boris Carmi in der "Akademie der Künste"
Eine
Ausstellung von Alexandra Nocke
(Kuratorin) in der Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557
Berlin-Tiergarten
15. Mai 2004 bis 27. Juni 2004
Von Martin Jander
Der Fotograf Boris Carmi (1914 – 2002) verfolgte mit
seiner Kamera über 60 Jahre lang Leben und Gesellschaft Israels. Anlässlich
seines 90. Geburtstages zeigt die Berliner "Akademie der Künste" erstmals
das Werk des Presse- und Dokumentarfotografen als Einzelausstellung
außerhalb seiner Heimat. Vorgestellt werden Fotografien aus der turbulenten
Phase der Staatsgründung 1948, des beginnenden Krieges mit den Arabern, der
Massen-Einwanderung aus aller Welt und der Wirtschaftskrise, aber auch
Porträts von Künstlern und Politikern. Seine Bilder berichten von den
enormen Herausforderungen, denen das junge Land ausgesetzt war.
Die Fotografien von Boris Carmi dokumentieren jedoch nicht
nur, sie erzählen auch Geschichten, die sich dem Betrachter nicht auf den
ersten Blick erschließen. Sie haben eine nicht sofort zu entschlüsselnde
künstlerische Bedeutung. Um welchen universellen Sinn es dabei geht, wird
dem Betrachter nicht gleich bewusst. Dass hier jedoch ein Subtext verborgen
sein muss, spürt er unmittelbar.
Alexandra Nocke jedenfalls, Kulturwissenschaftlerin und
Kuratorin der Ausstellung der Fotografien Carmis, hat die Ausstrahlung der
Bilder sofort erfasst. Als sie sich zur Vorbereitung ihrer Doktorarbeit über
israelische Identitätskonstruktionen ein Jahr in Tel Aviv aufhielt und dabei
den Fotografen und seine Bilder kennen lernte, "sprang mir" – sagt sie im
Interview – "das erzählerische Potential der Fotografien unmittelbar ins
Auge."
Mit beeindruckender Energie hat sie seit diesen Tagen den
Plan verfolgt, eine Auswahl der Bilder in einer Ausstellung zu präsentieren.
Vornehmlich auf sich selbst und ihre Faszination von den Bildern gestellt,
gelang es ihr schließlich ausreichend Sponsoren und Unterstützer zu finden.
Letztlich übernahmen sogar der scheidende Bundespräsident der
Bundesrepublik, Johannes Rau, und der israelische Staatspräsidenten Moshe
Katzaw die Schirmherrschaft für die am 14. Mai 2004 – 56 Jahre nach der
Proklamation des israelischen Staates – eröffneten Ausstellung in Berlin.
Sehr schnell erfasst hat wohl auch Matthias Flügge,
Vizepräsident der Akademie, die Kraft der Bilder. Als Alexandra Nocke vor
mehr als zwei Jahren mit einer Mappe der Fotografien Carmis bei ihm
auftauchte, habe er der Vorbereitung einer Ausstellung sofort zugestimmt.
Die Fotos von Carmi seien der Kunstkategorie "subjektive Autorenfotografie"
zuzurechnen, erläutert er in seiner Eröffnungsrede.
Allerdings macht er auch eine Bemerkung, die den politischen
Kontext der Ausstellung in der Bundesrepublik – und vielleicht Europa – sehr
scharf sichtbar werden lässt. Die Akademie wolle mit der Ausstellung
keinesfalls "einseitig Partei im Konflikt im Nahen Osten ergreifen", sagt
Flügge. Das Publikum der Eröffnungsfeier protestiert nicht. Für einen kurzen
Moment jedoch wird es sehr still. Ob Flügge eine solche Bemerkung auch im
Kontext von Fotografien eines russischen oder – nur als Beispiel –
norwegischen Künstlers gemacht hätte?
Sehr schnell hat die Bedeutung der Bilder Carmis sein Freund
Shlomo Arad erfasst, der bis vor einiger Zeit noch als Fotograf für die
Zeitschrift Newsweek arbeitete und der eigens zur Eröffnung der Ausstellung
nach Berlin gereist ist. Boris Carmi, der 2002 gestorben ist, hätte sich
sicher sehr über diese erste zusammenhängende Ausstellung seiner Bilder
außerhalb Israels gefreut, erläutert er im Gespräch. Bereits 1988 habe man
zusammen begonnen, die besten Fotos aus den mehr als 20.000 Negativen
zusammen zu tragen.
Es sei ganz eindeutig, dass viele der wirklich bedeutenden
Fotos von Carmi vor allem von Entwurzelung, Flucht und einem oft
konfliktreichen Neuanfang erzählten. Einsamkeit, Hoffnung, Desorientierung,
Verzweiflung und oft auch neuer Lebensmut, vor allem jedoch der Blick auf
jedes einzelne Gesicht seien das eigentliche Thema von Carmis Bildern. "Du
hast Dich der Aufgabe gewidmet, die Geschichten und die Gefühle der
orientalischen und europäischen Flüchtlinge und Vertriebenen zu erzählen,
die nach Israel kamen", habe er ihm einmal gesagt. "Und Du hast es gut
gemacht", habe er hinzugefügt. Carmi jedoch habe abgewehrt. Er habe
lediglich versucht, die Berichte der Korrespondenten, mit denen er als
Fotograf verschiedener Zeitungen in Israel, aber auch in Europa und Afrika
unterwegs war, durch einen anderen Gesichtspunkt zu ergänzen, habe er
bescheiden – zu bescheiden wie Shlomo Arad meint - erwidert.
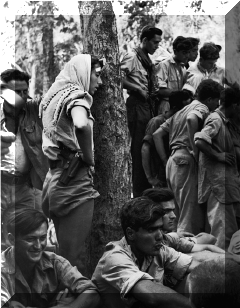
Palmach Treffen im Wald bei
Ben-Shemen, 1948
Zur Vergrößerung Bilder anklicken!
© Kobi Carmi
(Tel Aviv) |
Arad kann seine Bewertung der Bilder von Boris Carmi
besonders gut an einem der wohl berühmtesten Fotos von Boris Carmi aus
dem Jahr 1948 erläutern. Mitten in einer Gruppe von Soldaten lehnt sich
eine junge, schöne Frau an einen Baum. Sie trägt kurze Khaki-Hosen, eine
Pistole im Halfter und eine Kaffiyeh auf dem Kopf. Zu ihren Füßen sitzt
ein junger Soldat. Blickt man genauer auf seine linke Hand, entdeckt man
eine eingebrannte Nummer und weiß, dass er aus einem Konzentrationslager
gekommen ist. "Jahrzehnte lang galt dieses Bild als ein Symbol der
israelischen Identität schlechthin", erzählt Arad dem Reporter der
"Netzeitung" vor der Eröffnung der Ausstellung in Berlin. "Man hat das
Bild aber immer so geschnitten, dass man die Nummer auf der Hand nicht
sehen konnte." Erst 1996 habe er selbst das Foto für Carmi gedruckt und
dabei die Tätowierung entdeckt. |
Wer die Berliner Ausstellung, etwa 100 Fotos aus dem
Gesamtwerk Carmis, besucht, oder den gleichzeitig erschienenen Fotoband
ansieht, wird schnell feststellen, wie präzise Shlomo Arad die Bedeutung
dieser Bilder zu beschreiben vermag. Der Fotograf und Freund drückt es ganz
ähnlich aus wie György Konrad, von 1997 bis 2003 Präsident der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Künste, in seiner Eröffnungsrede. Sie
bildete den eigentlichen Höhepunkt der Ausstellungseröffnung.
György Konrád
übersetzte die Bilder Boris Carmis in kleine Geschichten: "Augen, vieles
wissende, sprechende Augen, sehen hinter dem, was sie sehen, auch noch etwas
anderes. Sie blicken in die Vergangenheit, dort verharren sie und sehnen
sich danach zurück, was nicht mehr vorhanden ist, nach einem Ort, der
anderswo ist. Aber wohin sollten sie von hier aus gehen? Es kommt ein Lehrer
oder ein Wissenschaftler mit seiner Familie daher: dunkelgrauer Anzug,
Krawatte, heller Hut, um ihn herum Wüste, staubige Wege, er sieht nach vorn.
Ein Einwanderer mit markanten Gesichtszügen in seinem neuen Zuhause schaut
vor sich hin; im Hintergrund schwirrt es geschäftig umher. Die aus Afrika
kommende junge Frau, die den Säugling an sich drückt, hat vielleicht
niemanden und nichts auf der Welt als dieses Baby.
| Der Fremdling mit Krawatte und
Stoppelbart blickt in die öde Welt. Realistische Blicke - nun ja, so ist
das eben - sie geben sich Rechenschaft über die neue Wirklichkeit. Nur
dieses neue Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es, darin müssen diese
Menschen ihr Zuhause finden. Doch das kleine Land ist auch ein buntes
Abenteuer; so viele verschiedenartige Menschen, komisch, dass das
Judentum so vielfarbig ist wie die Menschheit selbst. |
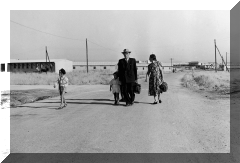
Neueinwanderer, 1950er Jahre
Zur Vergrößerung Bilder anklicken!
© Kobi Carmi
(Tel Aviv) |
Die Frau aus dem Jemen hockt vor dem verputzten Backofen,
versinkt, während sie in alten und schäbigen Töpfen kocht, in ihrer eigenen
Welt. Viel Resignation oder einfacher ausgedrückt Traurigkeit in den Augen.
Denn auch in den von Schönheit leuchtenden Augen lauert die Kenntnis der
Dunkelheit. Eine raue Gegend, primitive Gegenstände, die Menschen sind nicht
verwöhnt, vom Lastwagen laden sie ihre ärmlichen Habseligkeiten ab, auf der
Seite gaffen die Kinder. Dann stellt sich die Idylle ein; eine orientalische
Familie sitzt zusammen auf der Steinterrasse. Das entspricht ihrer Eleganz
in jedem anderen nahöstlichen Land, und auch in die Kamera würden sie so und
nicht anders schauen, während sie auf das leise Klicken warten."
Dr. Martin Jander, geb. 21.1.1955, Historiker, studierte
Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften an der Freien Universität
Berlin. Heute arbeitet er als freier Autor, forscht, lehrt und publiziert zu
den Themen Politische Theorien, Nationalsozialismus, Shoah und Deutsche
Nachkriegsgeschichte. Darüber hinaus ist er Mitarbeiter der Redaktion der
Zeitschrift „Horch und Guck“ und betreibt in Berlin die Stadtführungsagentur
"Unwrapping History".
György Konrád:
Eröffnungsrede zur Fotoausstellung Boris
Carmi
Veranstaltungen der "Akademie der Künste" in Berlin im
Rahmen der Ausstellung:
-
"POST INS GELOBTE LAND"
Lesung
2.6.2004
Hanseatenweg 10
Anna Seghers erzählt die Geschichte einer polnisch-jüdischen Familie, die
nach einem Pogrom über Wien und Kattowitz nach Paris emigriert und dort zu
bürgerlichem Wohlstand kommt. Nach vielen Jahren wandert der alte Vater noch
einmal aus - nach Palästina, seinem Traumziel - und der inzwischen
sterbenskranke Sohn versorgt über seinen Tod hinaus den Vater bis zu dessen
Lebensende mit "Post ins Gelobte Land".
Die Erzählung wird gelesen von Ulrich Matthes und Lena Stolze.
-
ZEITZEUGEN
Gespräch
3.6.2004
Hanseatenweg 10
In seinem autobiografischen Buch "Der Sohn des Rabbiners" erzählt der
Komponist Josef Tal in der für ihn charakteristisch launig-luziden Weise aus
seinen Erinnerungen: an die Kindheit und Jugend in Berlin, die Phase der
Emigration nach Palästina, sein Engagement beim Aufbau des Musiklebens im
jungen israelischen Staat. Wie Boris Carmi mit der Kamera, so hielt Josef
Tal seine Erlebnisse im Wort fest. Beide dokumentieren die schwierigen
Anfangsjahre Israels, das zur neuen Heimat wurde. Für Boris Carmi sprechen
die Fotos der Ausstellung; Josef Tal wird im Gespräch mit Alexandra Nocke,
der Ausstellungskuratorin, von den Lebensumständen, seinen Eindrücken und
Erfahrungen berichten.
hagalil.com
16-05-2004 |