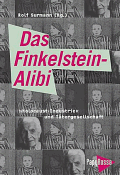
Rolf Surmann (Hrsg.), Das Finkelstein-Alibi.
'Holocaust- Industrie' und
Tätergesellschaft.
Papyrossa
Verlagsges. 2001
Euro 14,32
Bestellen? |
Ist die Debatte über die
Finkelstein-Thesen ein Wendepunkt in der öffentlichen
Auseinandersetzung um die deutsche Zeitgeschichte? Ungeachtet der
Tatsache, dass Finkelstein seine Polemik gegen jüdische
Organisationen nicht oder nur ungenügend mit Fakten untermauern
kann, hat eine breitere deutsche Öffentlichkeit mit Erleichterung
auf die Publikationen des umstrittenen New Yorker Autors reagiert.
Der nachfolgende Beitrag versucht, die Ereignisse einzuordnen und
die Aussagen zu analysieren.
Über mangelnde Aufmerksamkeit in Deutschland hat sich der Politologe
Norman Finkelstein nie beklagen können. Schon in der Debatte um
Goldhagens umstrittene Forschungsergebnisse stilisierte man ihn, der
zum Thema gar nicht wissenschaftlich gearbeitet hatte, in den Medien
zu dessen Gegenspieler. Im vergangenen Jahr fand ähnliches statt.
Obwohl er vorher nichts Nennenswertes zur Fragestellung publiziert
hatte, titelte die Berliner Zeitung am 28. Januar 2000: "Schwere
Vorwürfe gegen die Jewish Claims Conference. US-Historiker:
Entschädigungsgelder gingen nicht an Opfer."
In einem Interview behauptete
Finkelstein dann, es habe schon einmal Verhandlungen über die
Entschädigung von Zwangsarbeit gegeben, "die gleichen Verhandlungen
wie heute, und mit den gleichen Leuten. Auf Grund des damals
ausgehandelten Abkommens wurde die JCC 1953 beauftragt, bis 1965
jährlich zehn Millionen Dollar an die Opfer, also auch an die
Sklavenarbeiter, zu verteilen". Doch plötzlich habe die
"Wiederherstellung des jüdischen Gemeinwesens" im Mittelpunkt
gestanden.
Finkelstein bezog sich
offenbar auf das Luxemburger Abkommen, das 1952 zwischen den
Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und Israels sowie der
Claims Conference geschlossen worden war. Ohne auf Details
einzugehen, kann hierzu allgemein gesagt werden, dass seine
Darstellung den Tatsachen nicht entspricht. Denn zwischen der
Bundesregierung und der Claims Conference wurden zwei Protokolle
unterzeichnet. Protokoll Nr. 1 regelte die Grundaspekte einer
Entschädigungsgesetzgebung, die von deutscher Seite zu erlassen war
und die dann zum Bundesentschädigungsgesetz in seinen verschiedenen
Fassungen geführt hat.
Nach Protokoll Nr. 2 zahlte
die Bundesregierung analog zum Vertrag mit der israelischen
Regierung an die Claims Conference 450 Millionen Mark für die
"Unterstützung, Eingliederung und Ansiedlung jüdischer Opfer der
nationalsozialistischen Verfolgung" außerhalb Israels. Weder gab es
also eine spätere Umdeutung dieses Abkommens, noch war die Claims
Conference beauftragt, Entschädigungszahlungen für ehemalige
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu leisten. Und nicht
zuletzt: Bei den jetzt abgeschlossenen Verhandlungen war der
Ausgangspunkt die Entschädigung für vorenthaltene Lohnzahlungen, für
die die deutsche Seite Ausgleichszahlungen prinzipiell verweigert
hatte.
Auf diesen Sachverhalt
hinzuweisen hat nicht in erster Linie inhaltlich korrigierende
Bedeutung. Er macht vor allem erkennbar, wie das Blatt geradezu
versessen darauf war, die abstrusen Behauptungen eines
unausgewiesenen Autors in die Öffentlichkeit zu bringen. Die
umgehend von der Claims Conference aufgesetzte Gegendarstellung
hätte dann spätestens der Augenblick sein müssen, selbst zu
recherchieren und mit einer Entschuldigung für die eigene
journalistische Fehlleistung von dem Thema zu lassen. Statt dessen
brachte die Berliner Zeitung jedoch weitere Beiträge, in denen zwar
die Darstellung der Claims Conference prinzipiell bestätigt wurde,
aber durch deren Erscheinen allein schon der Eindruck einer
"Debatte" entstand.
Dieser Vorgang ist nur
erklärbar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß Anfang des Jahres 2000
der Stand der Entschädigungsverhandlungen wenig Hoffnung auf ein
vernünftiges Ergebnis ließ. Die Stimmung war gereizt. Ein Beispiel
hierfür ist eine Formulierung im Vorspann zum Finkelstein-Interview,
in dem von "Ablasszahlungen" die Rede ist, über deren Annahme man
schon froh sein müsse. Welch ein groteske Verdrehung nach mehr als
50 Jahren der Entschädigungsverweigerung und angesichts der stark
abweichenden Meinungen über das notwendige finanzielle Volumen des
geplanten Fonds. Nur auf den ersten Blick scheint es deshalb ein
Widerspruch zu sein, daß die Zeitung ansonsten in ihren Kommentaren
für einen "Schluss-Strich" unter die Entschädigungspolitik
plädierte. Die "Ablasszahlungen"-Passage drückt bereits den ganzen
Unwillen darüber aus, mit diesen Forderungen überhaupt konfrontiert
zu sein. In dieser Situation kam ein Finkelstein offensichtlich
gerade recht.
Rege Rezeption des
Finkelstein-Buches
Das Erscheinen der englischen
Ausgabe des Finkelstein-Buchs im Sommer 2000 und der deutschen in
diesem Februar zeigten dann, daß alles Bisherige allenfalls die
Ouvertüre war. Der Grund hierfür war nicht in erster Linie der Text
selber. Die FAZ machte mit dem Bild, Finkelstein habe "ein Fenster
aufgestoßen", deutlich, worum es ging. Zwar wurde im Verlauf der
Debatte durchaus konzidiert, dass er nichts aufgedeckt hatte,
worüber es sich zu diskutieren lohne, aber mit Rückgriff auf den
jüdischen Kronzeugen konnte offensichtlich artikuliert werden, was
schon lange auf Ausdruck drängte. Die Süddeutsche Zeitung faßte es
mit Berufung auf den Economist trotz vorsichtiger Distanzierung in
die Worte: "Doch sein Grundargument, das Gedenken an den Holocaust
werde entwürdigt, ist ernst und sollte ernst genommen werden."
Es erhoben sich also die
Kinder und Kindeskinder der NS-Täter gegenüber den noch lebenden
Verfolgten und erklärten sich in einer Situation, in der sie den
wenigen noch lebenden Opfern dieser Verbrechen elementare
finanzielle Ausgleichszahlungen weiterhin vorenthielten, mit
Berufung auf Finkelstein zu den eigentlichen Hütern der Erinnerung.
Dass hierbei dessen Auschwitz-Relativierung unerwähnt blieb, fügt
sich ins Bild.
Wie ernst der Anspruch
gemeint war, Deutungsmacht zu erlangen und zu sichern, zeigte die
allgemeine Empörung, die zunächst Salomon Korn und dann Paul Spiegel
entgegenschlug, als sie die Ansicht äußerten, die Veröffentlichung
des Finkelsteins-Buchs in Deutschland sei angesichts neonazistischer
Tendenzen und sich verstärkendem Antisemitismus kontraproduktiv. War
Ignatz Bubis zwar weitgehend isoliert in der Auseinandersetzung mit
dem Schriftsteller Walser, so galt er aber doch als ein prinzipiell
gleichberechtigter Gegner. Dieses Glück hatten Korn und Spiegel
nicht. An ihren Stellungnahmen wurde vielmehr exemplifiziert, was
Demokratie und Freiheit des Wortes bedeuten. Doch fehlte das
fürsorgliche Argument nicht, daß die anhaltende Weigerung,
angebliches jüdisches Fehlverhalten in den Mittelpunkt deutscher
Reflexion zu rücken, Antisemitismus nur fördern würde.
Dieses hartnäckige Beharren
auf Kritik mit wechselnden Begründungen zeigt, daß die Zeiten
indirekter Unmutsäußerungen, die bisher vor allem im Hinblick auf
Anwälte oder mit Bezug auf Detailfragen geäußert wurden, offenbar
vorbei sind. Jüdische Organisationen wie die Claims Conference sind
jetzt direkt Angriffen ausgesetzt, bei denen die Faktengrundlage
allenfalls sekundär ist. Das Gespür für die Notwendigkeit, deutsche
Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten, tritt demgegenüber zurück.
Ein Beispiel für diese neue
Tendenz war eine Diskussionsrunde im Fernsehen, an der unter anderen
die Autorin eines vorher gezeigten Films über das Finkelstein-Buch
und der ehemalige deutsche Verhandlungsleiter Lambsdorff teilnahmen.
Während Lambsdorff die Verhandlungen als – sagen wir – normalen
politischen Alltag darstellte, sah die junge Autorin die
Notwendigkeit zu einer kritischen Aufarbeitung der Entschädigung.
Sie meinte damit nicht etwa die noch immer andauernden
Verweigerungen auf deutscher Seite. Im Sinne Finkelsteins zielte sie
vielmehr auf die kritische Aufarbeitung des Verhaltens jüdischer
Repräsentanten. Sie verschärfte damit eine Blickrichtung, die längst
unter der Prämisse formuliert worden war, die Nachkriegsgeschichte
Deutschlands nicht unter dem Aspekt ihrer nazistischen Belastungen
zu untersuchen, sondern als "demokratische Erfolgsgeschichte". Nun
mag man Lambsdorffs Position als Rechtfertigung seines politischen
Werks relativieren, doch war er derjenige, der der Filmemacherin am
heftigsten widersprach. Er hatte offensichtlich – und damit auch die
politische Kultur, für die ersteht – mehr oder weniger den
Sachverhalt akzeptiert, nachdem er und sein politisches Umfeld sich
in einem gewissen Ausmaß internationalem Druck hatten beugen müssen.
Mit Berufung auf Finkelstein
formiert sich jedoch eine gesellschaftliche Strömung, die nicht nur
auf einen Schluss-Strich unter Entschädigungsleistungen zielt,
sondern unter Umständen auch ein Ausscheren aus den internationalen
Bemühungen intendiert, zum Beispiel mit weltweiten
Untersuchungskommissionen, wie sie im Gefolge der Schweizer Debatte
über die Vermarktung von NS-Raubgold entstanden sind, die
entschädigungs- und erinnerungspolitischen Konsequenzen des Kalten
Krieges aufzuarbeiten. Sie schnitte damit auch Fragen wie der nach
der "vitale(n) Vergeßlichkeit" ab, die Dolf Sternberger gegenüber
der Adenauer-Zeit formulierte und die Norbert Frei Ende der 90er
Jahre in seiner Untersuchung über "Vergangenheitspolitik" erneut
aufnahm.
Der Scheideweg, der sich
spätestens seit der Walser-Rede auftut, tritt also deutlicher
hervor. Sicher ist es notwendig darauf zu achten, was künftig "zur
Tür hereinkommen" wird, nachdem Finkelstein "ein Fenster
aufgestoßen" hat. Es greift aber wohl zu kurz, wenn kritische
Stimmen lediglich darauf verweisen, der rechte Rand dieser
Gesellschaft würde durch die Angriffe Finkelsteins gestärkt. Von
größerer Bedeutung dürfte sein, dass die so genannte Mitte der
"Berliner Republik" durch ihre Affirmation der finkelsteinschen
Ideologie Positionen einnimmt, die bisher der radikalen Rechten
vorbehalten waren. Das könnte fürwahr ein denkwürdiges Finale
deutscher "Wiedergutmachung" sein.
Rolf Surmann ist Herausgeber
des Buches: Das Finkelstein-Alibi. "Holocaust-Industrie" und
Tätergesellschaft (ISBN: 3-89438-217-1), welches in diesen Tagen im
Papyrossa-Verlag in Köln erscheint.
Nachtrag:
Das
Buch ist mittlerweile erschienen, umfaßt 176 Seiten und
kostet 28 Mark. Es enthält u.a. Beiträge von
Micha Brumlik (Die Graduierung des Grauens),
Ulrike Winkler (Die Kontroverse über die Entschädigung von
NS-Zwangsarbeit),
Lars Rensmann (Entschädigungspolitik, Erinnerungsabwehr und Motive
des sekundären Antisemitismus),
Moshe Zuckermann (Instrumentalisierung der Erinnerung. Reflexionen
aus israelischer Sicht),
Wolfgang Wippermann (Ein "Spezialist für Israelfragen". Finkelstein
gegen Goldhagen und andere "jüdische Geschäftemacher") und
Rolf Surmann (Der jüdische Kronzeuge. Finkelsteins Pamphlet als
zeitgeschichtlicher Paradigmenwechsel).
Vom selben Autor:
Der lange Schatten der NS- Diktatur
Texte zur Debatte um Raubgold und Entschädigung
haGalil onLine 03-05-2001 |