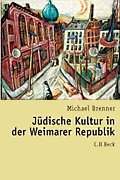
Michael Brenner
Jüdische Kultur in der Weimarer Republik
C.H. Beck, München 2000
ISBN 3-406-46121-2
Euro 34,90
Bestellen? |
"Bis zu
diesem bemerkenswerten Buch hatten wir nur eine vage Vorstellung von
der vibrierenden und vielschichtigen, spezifisch jüdischen Kultur,
die die Juden der Weimarer Zeit hervorgebracht haben. Michael
Brenner zeigt uns, daß das Weimarer Judentum sich weit stärker mit
seinem jüdischen Erbe auseinander setzte, als wir bislang gewußt
haben. Sein gründlich recherchiertes, überzeugend argumentierendes
und angenehm lesbar geschriebenes Buch wird Historiker wie
interessierte Leser gleichermaßen beeindrucken." Michael M. Meyer
Endlich ist dieses Buch in deutscher Übersetzung erschienen, nachdem
es bereits 1996 unter dem englischen Orginaltitel "The Renaissance
of Jewish Culture in Weimar Germany" publiziert wurde. Bis dahin gab
es noch keine entsprechende Überblicksdarstellung zur jüdischen
Kultur in der Weimarer Republik, lediglich Untersuchungen zu
einzelnen Juden und ihrem kulturellem Beitrag.
Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der
Universität München, räumt darin mit dem herkömmliche Bild der Juden
in der Weimarer Zeit gründlich auf. Das Bild vom "Judentum ohne
Juden", also Juden, die komplett assimiliert sind, keine
eigenständige Kultur schaffen, sondern ihren Beitrag zur deutschen
Kultur leisten, hat sich auch hartnäckig in der Historiographie
gehalten, wie bereits Fritz Stern kritisierte.
Tatsächlich gab es sehr wohl eine eigenständige jüdische Kultur in
der Weimarer Republik, was Michael Brenner eindrucksvoll darlegt. Es
bildete sich das, was Franz Rosenzweig als "selbständige jüdische
Sphäre" bezeichnete, also ein kultureller Bereich, der den
Fortbestand der eigenen jüdischen Identität in einer nicht-jüdischen
Umwelt erlaubte.
Die Folge war, dass Juden oft mit mehreren Identitäten lebten,
"ein und derselbe Schriftsteller bezog seine Inspiration aus
deutschen Heldensagen und aus chassidischen Geschichten, ein und
derselbe Pädagoge war in der Erwachsenenbildung der deutschen
Volkshochschule und in der des jüdischen Lehrhauses tätig, ein und
derselbe Maler bildete deutsche Soldaten und Ostjuden ab, ein und
derselbe Architekt baute Warenhäuser und Synagogen." (S. 12)
An dieser speziellen Kultursphäre beteiligte sich allerdings nicht
der überwiegende Teil der deutschen Juden, vielmehr handelte es sich
um eine singuläre Leistung, die beeinflußt waren von den
unterschiedlichen kulturellen und politischen Identifikationen in
der Weimarer Zeit, wie zum Beispiel dem Centralverein oder dem
Zionismus.
Mit der rechtlichen Gleichstellung von 1871 hatte die große Mehrheit
der deutschen Juden bereits die deutsche Kultur übernommen, nur noch
eine immer kleiner werdende orthodoxe Minderheit beschäftigte sich
mit dem Studium der hebräischen Quellen. Um die Jahrhundertwende kam
es dann aber zu einer "Jüdischen Renaissance" - den Begriff prägte
Martin Buber.
Die Frage nach dem Wesen des eigenen Jüdischseins stellte in der
modernen Welt große Probleme, denn die Religion allein ist eine
schwierige Definition für eine stark säkularisierte jüdische
Gesellschaft: "Jene Juden, die sowohl die Ansicht verwarfen, das
Judentum könne rein religiös definiert werden, als auch der
Auffassung widersprachen, die Juden sollten sich vollständig an die
deutsche Gesellschaft assimilieren, sahen sich also mit dem
zentralen Problem jüdischer Existenz in der modernen säkularen
Gesellschaft konfrontiert: Wie war eine neue Form des Judentums zu
schaffen, und mit welchem Inhalt sollte diese gefüllt werden?"
(S. 14)
Eine Form der Lösung findet man in der Weimarer Zeit. Denn jüdische
Kultur war weder ein radikaler Bruch mit der eigenen Vergangenheit
noch die Rückkehr dazu. Vielmehr bildet sie eine Mischform, die
bestimmte Teile der jüdischen Kultur in modernem zeitgenössischem
Geschmack präsentierte: "Was den Anschein des Authentischen
erwecken mochte, war in Wirklichkeit moderne Innovation." (S.
15)
Michael Brenner untersucht alle literarischen, künstlerischen und
wissenschaftlichen "Orte", die kollektive Identität stiften wollten,
also Theater, Clubs, Vereine, Verlage und Schulen. Dabei entschied
er sich dafür, die Vielfältigkeit der jüdischen Kultur in der
Weimarer Republik zu zeigen, nicht einzelne Institutionen oder
Personen, sondern das gesamtes Spektrum der jüdischen Kultursphäre.
Wenn auf diese Weise auch sicherlich nicht alle Aspekte behandelt
werden können, ist doch das Wichtigste enthalten.
haGalil onLine 28-12-2000 |