|
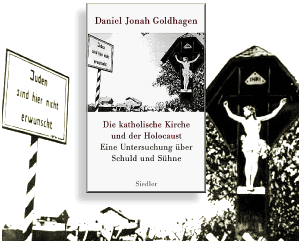
Antisemitismus im Katholizismus:
Moral und Geschichte
Hierzulande scheint es besonders schwer zu sein, offen über moralische
Fragen von Schuld und Sühne zu sprechen. Das zeigen die jüngsten
Reaktionen auf Daniel Jonah Goldhagens Buch über die Verstrickung der
katholischen Kirche in die Verbrechen des Holocaust und die Problematik
einer moralischen Wiedergutmachung.
Vor etwa drei Jahren bat Martin Peretz, Herausgeber der
amerikanischen Zeitschrift
The New Republic, Daniel Goldhagen um eine ausführliche Besprechung
einiger Neuerscheinungen zu Papst Pius XII. Die Arbeit nahm überraschende
Ausmaße an und führte Goldhagen, wie er selbst zu Beginn seines Buches
erklärt "in eine gänzliche unerwartete Richtung (...), die nicht nur einen
längeren Artikel erforderte, sondern auch eine Untersuchung und Abhandlung
in Buchlänge, um unsere Frage zu beantworten: Was muss eine Religion der
Liebe und Güte tun, um sich ihrer von Hass und Unrecht geprägten
Vergangenheit zu stellen und Wiedergutmachung zu leisten?" (S.47)
Der Artikel erschien zunächst in The New Republic vom 21. Januar
2002, das entsprechende Buch, Die katholische Kirche und der Holocaust.
Eine Untersuchung über Schuld und Sühne, kam in Deutschland am 27.
September dieses Jahres in den Handel – oder auch nicht, doch davon
später. Als Daniel Goldhagen im Oktober nach Deutschland kam, um sein Buch
vorzustellen, stand er sogleich im Zentrum erhitzter Debatten, denn es
ging um weit mehr als nur die katholische Kirche. Es ging um so moralisch
belastete Begriffe wie Schuld und Sühne, und mit Moral, gar moralischen
Urteilen, tun wir uns schwer in der heutigen Zeit, vor allem in
Deutschland: "Ein Politikwissenschaftler, ein Historiker, der Moral
treibt, der sich hier als Sittenwächter aufspielt, verfehlt sein Fach. Das
würde in Deutschland nicht möglich sein." So der Kirchenhistoriker Georg
Denzler in einer vom Südwestdeutschen Fernsehen am 10. Oktober
übertragenen Podiumsdiskussion mit Goldhagen. Die Historiker, zumal
Kirchenhistoriker, hadern wieder einmal gewaltig mit dem amerikanischen
Politikwissenschaftler. Goldhagen, so der Generalvorwurf, habe keine
Primärquellen studiert, habe aus zweiter Hand und fehlerhaft zitiert,
seine Aussagen seien erstens nicht neu und zweitens vom aktuellen
Forschungsstand längst überholt (kurioserweise wird in diesem Zusammenhang
von kaum einem Kritiker etwas aktuelleres angeführt als Rolf Hochhuths vor
fast 40 Jahren uraufgeführtes Theaterstück "Der Stellvertreter"). Das Buch
sei ein Pamphlet, eine Katastrophe und voller Fehler.
Manche dieser Äußerungen erinnern an die Debatten über Goldhagens vor
sechs Jahren erschienenes Buch Hitlers willige Vollstrecker. Welche
Einwände auch immer gegen Goldhagens Thesen bestanden oder bestehen mögen,
Stil und Vehemenz der Abwehr irritieren.
Im Vorwort zu
Hitlers willige Vollstrecker schrieb Goldhagen: "Ich möchte mit meiner
Beweisführung und Interpretation der Quellen deutlich machen, warum und
wie der Holocaust geschah, ja warum er überhaupt möglich werden konnte. Es
geht mir dabei um historische Erklärung, nicht um moralische Beurteilung."
Dennoch, so Goldhagen in der Einführung seines aktuellen Buchs: "Hitlers
willige Vollstrecker hatte ungewollt einen moralischen Aufruhr
ausgelöst und war ständig von einem moralischen Subtext umgeben, der die
ausgiebige schriftliche und mündliche Diskussion teilweise entgleisen
ließ. (...) Dies alles machte zwar unausgesprochen, aber doch
nachdrücklich die bislang weithin gemiedene Frage unausweichlich: Wer ist
schuldig in welchem Sinne und wofür?
(...) Sollte
Hitlers willige Vollstrecker dazu beitragen, die Umrisse und Ursachen
des Holocaust zu erklären und vor allem die Menschen wieder als Akteure
dabei zu begreifen, so soll dieses Buch helfen, die moralische Schuld zu
klären, die Akteure zu beurteilen und darüber nachzudenken, wie sie das
von ihnen begangene Unrecht am besten sühnen können." (S. 11ff)
Mit dieser moralischen Überprüfung der Institution
Kirche, speziell der katholischen Kirche, sowie ihrer Vertreter und deren
Handlungen angesichts der Judenverfolgung, will Goldhagen keine
historische Gesamtdarstellung liefern, sondern vielmehr über den
exemplarischen Fall hinaus allgemeingültige Lösungsvorschläge und
Denkmodelle für aktuelle und zukünftige Auseinandersetzungen über
Verantwortung und Wiedergutmachung entwickeln.
Es beginnt mit der Frage, wie das Verhalten Eugenio
Pacellis, des späteren Papst Pius XII. vor und während der NS-Zeit zu
verstehen ist. Da Pius XII. zwar ein wichtiger, aber eben doch nur ein
kleiner Teil der Institution Kirche ist, dehnt Goldhagen seine Analyse
auch auf Papst Pius XI. sowie die nationalen Kirchen, Bischöfe und
Priester aus und kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis: "Der
Antisemitismus war ein fester Bestandteil der katholischen Kirche" (S.
54). Die Belege, die Goldhagen für diese Aussage anführt, stammen zum
größten Teil aus eben jenen Büchern, die er für The New Republic
besprochen hatte, und auch ein großer Teil seiner Rezension selbst hat
in diesen ersten Teil seines Buches Eingang gefunden. Goldhagen macht
daraus durchaus kein Geheimnis, sondern verweist absolut korrekt auf den
Ursprung seiner Arbeit ebenso wie auf die Quellen – primäre wie sekundäre.
Der gelegentlich unterschwellig anklingende Vorwurf, er habe sich quasi
unrechtmäßig die Arbeit anderer Wissenschaftler angeeignet, ist ebenso
abwegig, wie der Hinweis darauf, dass er nur altbekanntes wiederhole, denn
den Anspruch mit diesem Buch als erster unbekannte Fakten ans Tageslicht
befördert zu haben, erhebt Goldhagen gar nicht. Ob diese Fakten allerdings
einer breiteren Öffentlichkeit außerhalb der akademischen Zirkel bekannt
sind, ist zu bezweifeln.
In jedem Fall birgt Goldhagens Art der Beweisführung aus
zweiter Hand gewisse Risiken, die der Kritik eine breite Angriffsfläche
bieten. Ein Beispiel, das bereits häufiger zur Sprache kam, ist ein
vertraulicher Brief, den Pacelli im April 1919 während eines Aufenthaltes
in München schrieb. Für Goldhagen ist dieses Schreiben ein Beweis für die
antisemitische Einstellung Pacellis, denn es enthält eine Beschreibung
russischer Revolutionäre, in der nicht nur "irgendeine Bemerkung" fällt,
sondern die "vielmehr einem Trommelfeuer von antisemitischen Stereotypen
und Vorwürfen gleicht" (S.63). Goldhagen zitiert diesen Brief nach John
Cornwell und dessen Buch:
Pius XII. Der Papst, der geschwiegen hat, und das war wohl ein
Fehler.
In der erwähnten Diskussionsrunde des Südwestdeutschen Fernsehens führte
der Münchner Historiker Thomas Brechenmacher aus, dass sowohl Cornwell als
auch Goldhagen auf eine falsche Übersetzung zurückgegriffen hätten.
Brechenbachers korrigierende Wiedergabe vereinzelter Formulierungen aus
einem längeren Schreiben kann zwar auch nicht jeden Zweifel ausräumen, was
den übrigen Inhalt des Briefes angeht, doch ist eines nicht von der Hand
zu weisen: Eine moralische Prüfung und erst recht ein moralisches Urteil
erfordern zu allererst eine sorgfältige Beweisführung. Indem Goldhagen
sich überwiegend auf die Beschreibungen anderer verlässt, deren subjektive
Einschätzungen oder Fehleinschätzungen übernimmt, zusätzliche
möglicherweise erklärende Faktoren nicht selbst auslotet, bietet er seinen
Kritikern eine höchst willkommene Gelegenheit, die dringend nötige
Diskussion über die Beteiligung der Kirchen an der Shoah in einen
Buchstabierwettbewerb zu verwandeln. Eine Gelegenheit, die, wie es
scheint, umso leidenschaftlicher genutzt wird, als man dadurch der
eigentlichen Problematik, die Goldhagen in seinem Buch zu Recht
formuliert, elegant aus dem Weg gehen kann.
Trotz mancher Fehler im Detail hat allerdings kein Kritiker ernsthaft
behauptet, dass das Gesamtbild, das Goldhagen von der Kirche, insbesondere
von den katholischen Kirchen, während der NS-Zeit zeichnet, völlig
unzutreffend sei. Selbst innerhalb der katholischen Kirche hört man seit
geraumer Zeit das vage Eingeständnis einer Mitschuld an der Verfolgung und
Ermordung der europäischen Juden. Vage insofern, als die offiziellen
Erklärungen der Kirche, in ihrer Wortwahl erstaunlich weich ausfallen,
verglichen mit den sehr viel pointierteren Verlautbarungen zu Themen wie
Biotechnologie oder Abtreibung. Im pontifikalen Schuldbekenntnis und der
damit verbundenen Vergebungsbitte vom März 2000 hieß es:
"Gott unserer Väter,
du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt,
deinen Namen zu den Völkern zu tragen:
Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller,
die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden ließen.
Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen,
dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes."
"Leiden lassen" ist eine bemerkenswert unpräzise Umschreibung für
Verfolgung und Massenmord. Fast genau zwei Jahre zuvor, im März 1998 wurde
in einer Erklärung der Kommission für die religiösen Beziehungen zu den
Juden "Wir Erinnern. Eine Reflexion über die Shoah" zwar vorsichtig
eingeräumt, dass die nationalsozialistische Verfolgung der Juden "durch
die antijüdischen Vorurteile in den Köpfen und Herzen einiger Christen
begünstigt wurde" und dass "vielleicht das antijüdische Ressentiment die
Christen weniger sensibel oder sogar gleichgültig" machte gegenüber dem
Schicksal der Juden, doch zugleich steht für diese Kommission fest:
"Die Shoah war das Werk eines typischen modernen
neuheidnischen Regimes. Sein Antisemitismus hatte seine Wurzeln außerhalb
des Christentums (...)"
"Antijudaismus" und Antisemitismus
Diese strikte Unterscheidung zwischen 'antijüdischen
Ressentiments', oder Antijudaismus, wie die Vertreter der Kirche es
nennen, und 'modernem neuheidnischen Antisemitismus' läßt Goldhagen nicht
gelten und verweist unter anderem auf diverse Ausgaben der Jesuiten
Zeitung Civiltà cattolica, die, gegründet 1850, gewissermaßen als
das Sprachrohr des heiligen Stuhls galt. Bereits gegen Ende des 19.
Jahrhunderts aber auch unmittelbar vor und nach Hitlers Machtergreifung
finden sich in dieser Publikation antisemitische Formulierungen, die von
denen eines Julius Streicher in seinem Hetzblatt
Der Stürmer kaum zu unterscheiden sind, wie einige Artikel belegen,
die Goldhagen in Auszügen zitiert:
"1922 hieß es zum Beispiel: 'Die Welt ist krank [...] Überall werden
Völker von unerklärlichen Krämpfen geschüttelt [...]' Wer ist daran
schuld? 'Die Synagoge.' 'Jüdische Eindringlinge' steckten hinter Russland
und der Kommunistischen Internationale, der größten Gefahr für die
Weltordnung. 1936 – die Nürnberger Gesetze waren erlassen, und die Juden
in Deutschland standen seit Jahren unter Beschuss – griff
Civiltà cattolica auf gängige antisemitische Floskeln der
NS-Propaganda zurück und warf den Juden vor, sie seien 'einzig und allein
mit den Eigenschaften von Parasiten und Zerstörern versehen' und zögen im
Kapitalismus wie im Kommunismus die Fäden, um durch einen Zangengriff die
Weltherrschaft an sich zu reißen. 1938 erinnerte sie an 'die anhaltenden
Verfolgungen der Christen, insbesondere der katholischen Kirche, durch die
Juden und an ihre Allianz mit den Freimaurern, den Sozialisten und anderen
antichristlichen Parteien.' (...)
Außerdem schlug sie eine noch extremere Lösung der vermeintlichen
Judenfrage vor, in eigenen Worten: 'drastisch feindselig' durch
'Vernichtung' " (S. 111f)
Selbst wenn man unterstellt, diese Artikel seien extreme
Ausnahmen, fällt es schwer dem Kirchenhistoriker Georg Denzler zu folgen,
der es Goldhagen wiederholt als "Kardinalfehler" ankreidete, nicht
zwischen kirchlichem Antijudaismus und modernem Antisemitismus
unterschieden zu haben, weil der Antisemitismus, so Denzler wörtlich "bei
der Kirche nie als Lehre vertreten ist. Sie müssen mir ein Dokument
bringen, wo ein Papst oder ein Konzil die Aufforderung erhebt: 'Schlagt
die Juden tot! Wir freuen uns, wenn Ihr die Juden totschlagt.' (...) und
da sehe ich den Grundfehler des Buches, dass man hier nicht differenziert,
dass man die Judenfeindschaft gleich mit Judenvernichtung identifiziert."
Diese Aussagen verdienen Aufmerksamkeit in zweifacher Hinsicht:
Erstens: Goldhagen lehnt zwar Begriffe wie "traditionelle
Judenfeindschaft" oder "Antijudaismus" als verschleiernd bzw. als
Selbstentlastungsversuch der Kirchen ab, doch eine Gleichsetzung des
kirchlichen Antisemitismus mit Judenvernichtung, wie Denzler sie
unterstellt, vollzieht er keineswegs:
"Der allgemeine Ausdruck 'eliminatorisch' sollte daher (...) nicht
Töten bedeuten, sondern den Wunsch oder das Bestreben ausdrücken, ein
Gebiet auf diese oder jene Weise von Juden und ihrem wirklichen oder
eingebildeten Einfluss frei zu machen (...).
Der Antisemitismus, den die Kirche unausgesprochen oder gar offen
verbreitet hatte, verlangte, die Juden aus der christlichen Gesellschaft
zu eliminieren, beispielsweise durch Zwangstaufe oder Ausweisung, doch
ihre massenhafte Ermordung forderten die Kirche und ihre Bischöfe nie, und
oft ermahnten sie ihre Gläubigen, keine Gewalttaten zu begehen." (S. 38,
Hervorhebung im Original)
An anderer Stelle heißt es: "Bedeuten die Bemerkungen Pius' XII., dass der
Charakter seines Antisemitismus derselbe war wie der Hitlers? Natürlich
nicht. Es gibt viele Spielarten des Antisemitismus, und sie unterscheiden
sich erheblich, was ihre Grundlagen, die Natur der gegen Juden erhobenen
Vorwürfe und die Intensität angeht. Bedeutet der Antisemitismus Pius'
XII., dass er notwendigerweise jeden Aspekt der Verfolgung der Juden durch
die Deutschen billigte? Natürlich nicht." (S. 66)
Zweitens: Die Erklärung, die Kirche habe nie verlangt
"Schlagt die Juden tot!" erinnert frappierend an jene zumal im
Nachkriegs-Deutschland weit verbreitete Beschwörung "Das haben wir nicht
gewollt!" - besonders oft zu hören, nachdem gewöhnliche Deutsche, was auch
immer sie zuvor gewußt oder geahnt haben mochten, durch die sogenannten
Wochenschauen im Kino oder, auf Druck der Alliierten Besatzung, durch
eigene Anschauung gezwungen wurden, das wahre Ausmaß der Verbrechen an den
Juden zur Kenntnis zu nehmen.
"Das haben wir nicht gewollt!" - Die Betonung lag fast immer auf
dem ersten Wort. - Die Juden totschlagen, Männer, Frauen und Kinder auf so
bestialische Art und Weise ermorden, das hat man also nicht
gewollt, aber was heißt das schon? Über der Monstrosität des Massenmords
in den Vernichtungslagern, dieser tödlichen Endstufe des eliminatorischen
Antisemitismus, werden seine alltäglichen Vorläufer gerne bagatellisiert,
als hätte die seit 1933 immer weiter fortschreitende publizistische,
berufliche und soziale Ausgrenzung der Juden aus der Gesellschaft und
nicht zuletzt die stillschweigende Billigung wenn nicht gar Unterstützung
dieser Maßnahmen durch die Mehrheit der Deutschen, nichts oder doch nur
wenig mit den ultimativen Verbrechen des Holocaust zu tun.
Wer wollte das heute noch ernsthaft behaupten? Goldhagen jedenfalls nicht
und mit dieser Haltung steht er keineswegs allein. Namentlich genannt
seien an dieser Stelle zum Beispiel der Historiker Olaf Blaschke und der
Theologe Stefan Moritz. Wie Goldhagen verwies auch Blaschke 1997 in einer
brillanten und auf breiter Quellengrundlage basierenden Gesamtdarstellung
über
Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich auf die
apologetische Absicht hinter der Trennung von Antijudaismus und
Antisemitismus: "(...) man verschleierte, Antisemit zu sein, während man
es doch war." (Blaschke: S. 31)
Goldhagens Einschätzung, " (...) dass der Antisemitismus für die
kirchliche Lehre und Theologie ebenso wie für ihre geschichtliche
Entwicklung insgesamt zentral war" (S. 253), würde
Blaschke nach seiner Untersuchung zwar nicht unterstützen, auch
spricht er sich gegen die Kontinuitätsbehauptung eines isolierten
'Auslöschungsantisemitismus' losgelöst vom Kontext des katholischen
Diskurses und seiner Motive aus, doch der Schlußsatz seiner Studie läßt
aufhorchen:
"Und gegen die aufrichtigen Selbstbezichtiger, die auf die 'Mitschuld' der
Christen hinweisen, weil sie gegen ihre Maxime, etwa die Nächstenliebe
verstoßen hätten und die Juden aufgrund eines Defizites an christlicher
Gesinnung verachtet hätten, steht zuletzt das Resumee: Die Katholiken
teilten stabile und auch moderne antisemitische Einstellungen, nicht
obwohl sie Christen waren, auch nicht weil sie sich als bloß charakterlose
Christen oder als schlechte Katholiken erwiesen. Vielmehr waren Katholiken
antisemitisch, gerade weil sie gute Katholiken sein wollten." (Blaschke:
S. 337)
Ebenfalls im Herbst 2002 erschien das Buch des
Österreichers Stefan Moritz mit dem Titel
Grüß Gott und Heil Hitler. Katholische Kirche und Nationalsozialismus in
Österreich. Moritz hat in verschiedenen Staats- und Diözesanarchiven
zahlreiche Primärquellen ausgewertet, darunter Hirtenbriefe, Pfarr- und
Gemeindeblätter sowie viele weitere offizielle katholische
Kirchenpublikationen und er kommt zu dem Ergebnis, dass die katholische
Kirche Österreichs sich nach dem sogenannten Wiederanschluss nicht nur
notgedrungen irgendwie mit den Nationalsozialisten arrangierte, sondern
dieses neue Regime in vielen Fällen durchaus freiwillig unterstützte.
Genau wie Goldhagen und Blaschke erkennt auch Moritz in der künstlichen
Abgrenzung von Antijudaismus gegen Antisemitismus die Tendenz zur
Verharmlosung. Er plädiert für den Begriff des 'katholischen
Antisemitismus' und belegt anhand zahlreicher Beispiele dessen untrennbare
Verknüpfung mit der modernen Rassenideologie der Nazis, so im Fall des
Pfarrers Franz Hlawaty und seiner Gemeinde in Erdberg im Sommer 1938:
"(...) tausende Menschen waren durch die Einführung der Rassengesetze
gezwungen, in der Pfarre den Nachweis ihrer Herkunft zu erkunden. Der
'Ariernachweis' war ein lebensnotwendiges Dokument. Für Pfarrer Franz
Hlawaty war die 'Mithilfe an der Familienforschung' nicht bloß eine
lästige Pflicht oder ein bürokratischer Aufwand, sondern in erster Linie
eine wichtige 'Seelsorgearbeit', die dem 'großen Werk des blut- und
artgemäßen Aufbaues' der 'Volksgemeinschaft' diente. (...)
Wohl wissend, dass es für die Betroffenen um Leben oder Tod ging, behielt
die Kirche diese Praxis auch in den Kriegsjahren bei. Im September 1939
schloss das Erzbischöfliche Ordinariat Wien eine Vereinbarung mit der
'Arbeitsgemeinschaft für Sippenforschung und Sippenpflege' ab. (...) Die
Präambel zu dieser Vereinbarung erläuterte den Sinn dieses Vorhabens: 'In
der Erkenntnis, dass eine planmäßige Bearbeitung der Kirchenbücher durch
Verkartung und Auswertung ihrer Eintragungen den Bluts und Sippengedanken
im Deutschen Volke wieder belebt und stärkt und zur Schonung und Erhaltung
der Kirchenbücher beiträgt ...' "(Moritz: S. 200; der Autor zitiert nach
Ausgaben des Erdberger Pfarrblatts und des Wiener
Diözesanblatts aus den Jahren 1938 und 1939)
Die moralische Schuld
Obwohl Stefan Moritz' fundierte Untersuchung der
österreichischen katholischen Kirche eine Menge Zündstoff für Debatten –
auch in Deutschland – enthält, werden Buch und Autor bis jetzt bei weitem
nicht so heftig attackiert wie Daniel Goldhagen. Das ist leicht zu
verstehen, denn während Moritz moralische Fragen nach Schuld und
Wiedergutmachung in seiner Darstellung weitgehend ausklammert, geht
Goldhagen den entscheidenden Schritt weiter. Er holt die Moral aus ihrem
gewohnten Versteck zwischen den Zeilen heraus und nennt Schuld und
Schuldige beim Namen. In klarer unmissverständlicher Sprache beschreibt er
das moralische Versagen einer großen Mehrheit der Kirchenvertreter und
ebenso deutlich fällt auch sein Urteil aus:
"Mit Sicherheit können wir sagen, dass eine beträchtliche Zahl von
Bischöfen und Priestern willentlich zur Vernichtung der Juden beigetragen
hat. Mit Sicherheit können wir ebenfalls sagen, dass der
niederschmetternde Mangel an Mitleid mit den Juden, den der Papst und der
Klerus bekundeten, ihre Beihilfe zu wichtigen verbrecherischen Akten, ihre
Unterstützung für viele weitere Taten und die Tragweite ihrer politischen
Verantwortung und Schuld die katholische Kirche eindeutig in die
Verbrechen verwickeln, die von Deutschen, Kroaten, Litauern, Slowaken und
anderen an den Juden begangen wurden." (S. 221)
Keine Frage, Goldhagens Sprache musste auf den
Blätterwald der neblig formulierten Publikationen katholischer Provenienz
wie ein Herbststurm wirken. Entsprechend verschnupft reagierten denn auch
folgerichtig und lautstark die Vertreter der Kirchen. Immer wieder wird
hervorgehoben, wie sehr sie selbst Opfer nationalsozialistischer
Verfolgung waren, wie viele Priester von der Gestapo verhaftet worden
seien, und selten fehlt der Hinweis auf vereinzelte Lichtgestalten wie
jenen Berliner Domprobst Bernhard Lichtenberg, der, nachdem er in seiner
Kirche für Juden gebetet hatte, 1941 nach Dachau geschickt wurde, wo er
unter ungeklärten Umständen umkam.
Muss hier wirklich noch einmal betont werden, dass Goldhagen keinen
Kollektivschuld-Vorwurf gegen alle Katholiken erhebt?
Unbestritten waren die Nazis auch der Kirche gegenüber extrem feindlich
eingestellt, doch erstens kann diese Bedrohung wohl kaum auf eine Stufe
gestellt werden mit der weitaus tödlicheren Gefahr, in der sich die Juden
befanden und zweitens galt gerade für letztere in dieser Zeit mehr denn je
die alte Binsenweisheit: Der Feind meines Feindes ist nicht
notwendigerweise mein Freund.
Wie groß auch immer die Bedrängnis der katholischen Kirche unter der
Nazi-Diktatur gewesen sein mag, sie führte nicht zu einer Solidarisierung
mit den Juden oder auch nur zu einem verstärkten Engagement für jüdische
Mitbürger, geschweige denn zu einem offenen Protest gegen ihre Verfolgung.
Wie Moritz' und Goldhagens Untersuchungen belegen, trat in vielen Fällen
eher das Gegenteil ein. Die lobenswerten Ausnahmen, jene christlichen
Helfer der verfolgten Juden, die Goldhagen sehr wohl und mit größter
Anerkennung erwähnt, handelten fast ausnahmslos auf eigene Initiative und
ohne jeglichen Rückhalt in ihrer Kirche.
Die moralische Wiedergutmachung
Vielleicht wäre der Aufschrei der kirchlichen Kritiker
etwas leiser ausgefallen, hätte Goldhagen über den Schuldspruch hinaus
nicht auch noch verschiedene Formen der Wiedergutmachung diskutiert und
dies ausgerechnet unter Anwendung der moralischen Grundsätze, die die
katholische Kirche selbst in ihrem Katechismus formuliert:
"Viele Sünden fügen dem Nächsten Schaden zu. Man muss diesen, soweit
möglich, wieder gutmachen (zum Beispiel Gestohlenes zurückgeben, den Ruf
dessen, den man verleumdet hat, wiederherstellen, für Beleidigungen
Genugtuung leisten). Allein schon die Gerechtigkeit verlangt dies."
(Katechismus der katholischen Kirche, Teil II, Abschnitt 2, Kapitel 2,
Artikel 4.7, § 1459; siehe auch
www.vatican.va, wo der
vollständige Text des Katechismus in englisch, italienisch, lateinisch und
spanisch nachzulesen ist)
Für Goldhagen ist jegliche Wiedergutmachung "eine
moralische, weil man mit diesem Wort die Verpflichtung benennt, einen
moralischen Schaden zu beheben" (S. 283) Dazu gehört neben einer
materiellen vor allem eine politische und eben jene rein moralische
Wiedergutmachung, die für die katholische Kirche darin bestehen müßte,
sich aufrichtig zu ihrer Vergangenheit zu bekennen, sie ehrlich zu
bereuen, den Antisemitismus als Ursache des Übels auszumerzen und dafür zu
sorgen dass die Institution Kirche "nie wieder Anlass zur Verfolgung von
Juden geben wird." (S. 296)
Die von der Kirche ausdrücklich formulierte Pflicht, das
"muss" einer Wiedergutmachung wird heute in der Regel von niemandem mehr
bestritten, nur über Ausmaß und Durchführung der Sühne gehen die Meinungen
auseinander und dies wohl am weitesten, was die rein moralische
Wiedergutmachung angeht, die Goldhagen hier diskutiert.
Voller Empörung wirft man ihm vor, dass er die vielen positiven
Entwicklungen, nicht zuletzt nach dem zweiten vatikanischen Konzil von
1962, hartnäckig ignoriere. Dazu ist zu sagen: Goldhagen ignoriert diese
Veränderungen
nicht (siehe S. 296 ff und 352f), doch er bezeichnet sie mehrheitlich
als unzureichend. Das ist erstens nicht dasselbe und entspricht zweitens
einer Einschätzung, die auch von einigen Katholiken geteilt wird (siehe
www.jcrelations.net). Nach
wie vor hält der Vatikan in seinen Archiven eine Fülle von Akten unter
Verschluss. Nicht einmal jene katholisch-jüdische Historikerkommission,
die eigens vom Vatikan eingesetzt worden war, um dessen Rolle während der
Nazi-Zeit zu untersuchen, erhielt uneingeschränkten Zugang zu allen
Dokumenten. Angeblich, so heißt es, wolle oder müsse man die
Persönlichkeitsrechte noch Lebender schützen. Denkt innerhalb dieser
Kirche auch jemand an die Persönlichkeitsrechte der immer kleiner
werdenden Zahl der Überlebenden, an ihr Recht, die Wahrheit
zu erfahren?
Wie leichtfertig selbst hohe Kirchenvertreter gelegentlich ihre
Vergangenheit schönreden, belegen auch die jüngsten Äußerungen Kardinal
Lehmanns, der in einem Interview mit der Illustrierten Stern ohne weitere
Nachprüfung oder Beweise erklärte, dass "von den etwa 900.000 Juden, die
im deutschen Machtbereich überlebt haben, 70 bis 80 Prozent ihre Rettung
den verschiedenen päpstlichen Maßnahmen und dem Einsatz der Nuntien
verdanken." (Stern Nr. 40 v. 26.09.2002) Dieser Behauptung haben einige
Historiker, darunter Raul Hilberg, David Bankier und Sergio Minerbi (der
selbst als Kind in einem katholischen Kloster in Rom versteckt wurde und
überlebte) prompt und heftig widersprochen. Die Zahlen seien massiv
überzogen und nicht zu belegen.
Goldhagen liefert noch eine Reihe anderer Beispiele für die fortbestehende
Tendenz der katholischen Kirche, sich durch verschleiernde Formulierungen
oder die Überbewertung der eigenen Opferrolle zu entlasten, statt sich
ihrer Vergangenheit mit der gebotenen Aufrichtigkeit und Reue zu stellen.
Alleine was diese zuletztgenannten Aspekte moralischer Wiedergutmachung
angeht, hätte die Kirche noch einen weiten Weg vor sich, doch um den
Antisemitismus auszumerzen und zu gewährleisten, dass die Kirche nie
wieder Anlass zu einer Verfolgung der Juden bietet, müsse sie, laut
Goldhagen, sowohl ihre religiösen Schriften als auch ihr theologisches
Selbstverständnis und ihre politisch-institutionelle Struktur einer
kritischen Revision unterziehen.
In der Phantasie einiger Kritiker mutierte Goldhagen damit endgültig zum
Katholikenfresser. Entsprechend irrational fielen denn auch manche
Kommentare aus, wonach Goldhagen angeblich verlange, die Bibel
umzuschreiben, den Vatikan aufzulösen und alles aufzugeben, was den
katholischen Glauben ausmache. Den peinlichen Höhepunkt dieser künstlichen
Hysterie lieferte Prof. Hans Maier, ehemaliger bayerischer Kultusminister,
der bei einer Podiumsdiskussion in München allen Ernstes fragte. "Müssen
wir jetzt alle Juden werden?"
Das geht nun allerdings so weit an Goldhagens Aussagen vorbei, dass man
sich fragt, ob von der jüngst diagnostizierten Leseschwäche unter
deutschen Schulkindern nicht noch ganz andere Altersgruppen betroffen
sind.
Nicht die Abschaffung der katholischen Kirche oder Lehre wird verlangt,
sondern Reformen. Nicht die Aufgabe des katholischen Glaubens wird
gefordert, sondern seine Erweiterung in der Toleranz gegenüber anderen
Religionen. Und was die Bibel angeht, sagt Goldhagen: "Um nicht
missverstanden zu werden: Ich sage nicht, dass die katholische Kirche ihre
Bibel verändern muss." (S. 363)
Das Bibelproblem
Goldhagen ist keineswegs so naiv, dass er sich anmaßt
einen annähernd 2000 Jahre alten heiligen Text mal eben korrigieren zu
können wie einen schlechten Schulaufsatz, doch er verweist zu Recht auf
ein nach wie vor bestehendes Problem: Es gibt im Neuen Testament eine
Vielzahl explizit antisemitischer Passagen und Formulierungen, die dem
christlichen Europa über Jahrhunderte den Vorwand geliefert haben, Juden
als Gottesmörder, Schlangenbrut oder Kinder des Satans zu stigmatisieren,
auszugrenzen, zu verfolgen und zu ermorden. Auch heute noch sind diese
Begrifflichkeiten geeignet, Argwohn und Vorurteile gegenüber Juden zu
fördern (Wer das nicht glauben will, den könnte eine Recherche auf
rechtsextremistischen Internetseiten schnell eines besseren belehren).
Die aus der katholischen Lehre selbst ableitbaren Forderungen bezüglich
moralischer Wiedergutmachung (den Ruf dessen, den man verleumdet hat,
wiederherstellen, für Beleidigungen Genugtuung leisten) besagen, "dass man
es nicht zulassen darf, dass das Übel des Antisemitismus, zu dem unbedingt
auch der in der christlichen Bibel enthaltene und sie beseelende
Antisemitismus zu zählen ist, im Herzen eines Menschen Wurzeln schlägt.
Doch die christliche Bibel ist ein heiliger Text, in den man, da er Gottes
Wort ist, nach Überzeugung von Katholiken und anderen Christen nicht
eingreifen darf. Was soll man tun? Was kann man tun?" (S. 355)
Goldhagen diskutiert verschiedene Lösungsmöglichkeiten von einer
Neu-Kommentierung bis zu einer konsequenten Entfernung aller explizit
antisemitischen Formulierungen und Passagen des Neuen Testaments. So
radikal und verstörend vor allem letztgenannte Überlegung klingen mag,
Goldhagen ist nicht so anmaßend zu behaupten, er habe die Lösung bereits
gefunden. Vielmehr erklärt er:
"Bei unseren Überlegungen müssen (...) drei Dinge bedacht werden: (1) Es
gibt keine offenkundige und einfache Lösung für dieses Problem; (2) sich
den problematischen Aspekten der christlichen Bibel zuzuwenden, ist nicht
einmal ausschließlich Sache der katholischen Kirche, weil der Text auch
von anderen christlichen Kirchen und Christen für heilig erachtet wird;
und (3) die Lösung muss, jedenfalls für Katholiken, am Ende aus dem
Inneren der Kirche selbst kommen." (S. 364)
Was Goldhagen hier nahe legt, ist eine Art erweitertes
vatikanisches Konzil unter Beteiligung
aller Christen, sowie Vertretern der jüdischen Religion, mit dem
Ziel, gemeinsam zu einer für alle akzeptablen Übereinkunft zu kommen, wie
die christliche Bibel zu ergänzen, neu zu kommentieren bzw. zu
interpretieren sei, damit sie keine antisemitischen Ressentiments mehr
produziert oder fördert.
Ginge es nach den Kirchenvertretern, besteht in dieser Hinsicht allerdings
wenig Handlungsbedarf. Immer wieder wird Goldhagen vorgehalten, die
jüngste Entwicklung in der Erörterung dieser theologischen Probleme nicht
zur Kenntnis genommen zu haben. Die geforderten Veränderungen in Sachen
Bibelauslegung seien längst gängige Praxis.
Gewiss, es gibt gute theologische Bücher und der
katholische Religionsunterricht wird heute von einer Reihe progressiver
Pädagogen und mit modernen Lehrmitteln gestaltet. Dennoch fragt man sich,
warum die in Deutschland derzeit aktuelle Schulbibel, eine explizit "für
den Schulgebrauch zugelassene" Einheitsübersetzung des Alten und Neuen
Testaments, erschienen im Herder Verlag, noch aus dem Jahr 1979 [!] stammt
und seitdem, abgesehen von einer neuen Einbandgestaltung, nicht verändert
wurde. Und wie zur Bestätigung Goldhagens findet man ebenda im Evangelium
nach Matthäus unter 27,24-26 jene Stelle, an der Pilatus seine Hände in
Unschuld wäscht, und das ganze jüdische Volk ruft: "Sein Blut komme über
uns und unsere Kinder!" Damit war laut Matthäus Jesus Todesurteil
besiegelt. Der auf der selben Seite mitgelieferte Kommentar dazu lautet:
"Das Volk gibt durch die Selbstverwünschung indirekt seine Verantwortung
zu." – Was liegt nach dieser Erläuterung näher als die Annahme: 'Irgendwie
sind also doch die Juden schuld!'? Auch zu anderen antisemitischen
Passagen, von denen Goldhagen einige in seinem Buch zitiert, findet sich
in dieser Schulbibel kein erhellender Kommentar. Kann oder besser darf
man sich allein darauf verlassen, dass progressive Religionslehrer diese
unhistorischen Falschdarstellungen eines ganzen Volkes durch eigene
Kommentare oder Sekundärliteratur korrigieren? Diese Schulbibeln –
zugelassen 17 Jahre nach dem zweiten vatikanischen Konzil und seit mehr
als 20 Jahren nicht überarbeitet – werden bis heute an allen deutschen
Schulen benutzt; angesichts dieser Tatsache kann man sich nur wundern,
woher einige der Kirchenvertreter die Selbstgewissheit nehmen, Goldhagen
vorzuwerfen, er sei nicht auf dem neusten Stand. Ist es nicht überaus
berechtigt, auf die schwerwiegende Problematik dieser tatsächlich
verleumderischen Bibelstellen hinzuweisen? Oder gelten die Regeln des
katholischen Katechismus – den Ruf dessen wiederherstellen, den man
verleumdet hat – nur dann, wenn die Geschädigten Katholiken sind?
Erinnert sei zum Beispiel an das Foto mit der falschen
Bildunterschrift. Der hohe katholische Würdenträger, der auf besagtem Bild
durch ein Spalier von SA-Leuten schreitet, ist nicht Kardinal Faulhaber,
wie es in der Bildlegende zunächst hieß, und so erwirkte das
erzbischöfliche Ordinariat München umgehend eine
gerichtliche Verfügung, die den Vertrieb des Goldhagen-Buches
solange unterbinden sollte, bis die strittige Zeile korrigiert wäre.
Kardinal Lehmann erklärte in einem kurzen Fernseh-Statement: "(...) es ist
natürlich misslich, wenn so etwas dann ausgerechnet einem Mann wie dem
Kardinal Faulhaber angelastet wird, der einer der mutigsten Leute war in
der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus." (12.10.2002, 3sat,
Kulturzeit extra) – Über die Rolle Kardinal Faulhabers während der NS-Zeit
gehen die Meinungen weit auseinander, aber nehmen wir zu seinen Gunsten
einmal das beste an und sagen, er wäre tatsächlich der mutige Mann
gewesen, den Kardinal Lehmann in ihm sieht.
Dass sich in Bildlegenden mitunter Fehler einschleichen, ist nicht neu und
menschlich verständlich. Ebenso verständlich ist andererseits, dass die
Kirche einen vermeintlich aufrichtigen Kardinal nicht in die Nähe der
Nazis gerückt sehen will. Dies, so die Kirche, sei eine Verleumdung und
damit eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, das auch noch für
Verstorbene gelte. Wie gesagt: ein solcher Einwand ist grundsätzlich
berechtigt und verständlich. – Dennoch, mit Blick auf die erwähnten
Schulbibeln erscheint die zur Schau getragene Empörung, mit der das
Münchner Erzbistum sein Recht einklagte, reichlich scheinheilig, und es
drängt sich mit Matthäus 7,3 die Frage auf: "Warum siehst du den Splitter
im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem [eigenen] Auge bemerkst
Du nicht?"
Warum tritt die Kirche für das Persönlichkeitsrecht der
Juden, für deren unbestreitbares Recht, in der christlichen Bibel nicht
länger falsch und verleumderisch dargestellt zu werden, nicht mindestens
mit dem selben Engagement ein, wie andererseits für das
Persönlichkeitsrecht ihrer eigenen Glaubensbrüder?
Die Bildunterschrift in Daniel Goldhagens Buch wurde
korrigiert. Das ist ein relativ einfacher Vorgang bei einem herkömmlichen
Buch. Schließlich ist es nicht das Wort Gottes
– Allerdings: das war das Neue Testament seinem Ursprung nach auch
nicht. Die Autoren dieser Schriften waren Menschen, und wie alle Menschen
waren sie nicht frei von Fehlern und Irrtümern. Dies zuzugeben und die
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, ist nur für die ein Problem, die
unbeirrbar an ihrer eigenen Unfehlbarkeit festhalten, und das trifft
insbesondere auf die katholische Kirche und ihr traditionelles
Selbstverständnis zu.
So gesehen erscheint die eingangs erwähnte Vehemenz, mit
der vor allem katholische Kirchenvertreter und Historiker Autor und Buch
attackieren, zumindest psychologisch nachvollziehbar. Die interessierte
Öffentlichkeit steht dieser Art von Kritik jedoch eher skeptisch
gegenüber, und in Erinnerung an ähnliche Töne in den Debatten über
Hitlers willige Vollstrecker
dürfte sich mancher sagen: Selber lesen wäre auch eine Möglichkeit. Selbst
wenn die eine oder andere Detailkritik berechtigt sein mag, und auch wenn
man Goldhagens Überlegungen nicht in jeder Hinsicht folgen will oder kann,
bleibt festzuhalten, dass die überaus berechtigten Fragen nach Schuld und
moralischer Wiedergutmachung bisher wohl selten so deutlich und radikal
formuliert wurden wie von Daniel Goldhagen. Die Antworten, besonders jene
der katholischen Kirche, stehen in vielen Fällen noch aus.
[Bestellen]
Goldhagen, Daniel Jonah: Die Katholische Kirche und der
Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne. Berlin, 2002: Siedler
Verlag.
Franziska Werners – haGalil 03.11.2002
Weitere Literatur zum Thema

[Bestellen] |
Blaschke, Olaf: Katholizismus und
Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich. Göttingen (1997) 1999²:
Vandenhoeck & Rupprecht (= Kritische Studien zur
Geschichtswissenschaft 122).
"Blaschke ist nicht der erste, der das starke
antisemitische Element im deutschen Katholizismus zur Sprache bringt.
Aber noch nie ist dieses Thema auf so breiter Quellengrundlage und so
schonungslos abgehandelt worden wie in dieser Studie. ...
Blaschke ordnet beides, Tradition und
Traditionsbruch, in große Zusammenhänge ein. Er sieht den deutschen
Fall nicht isoliert, vergleicht vielmehr den katholischen
Antisemitismus des Kaiserreiches mit dem Antsemitismus der Katholiken
in Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Vereinigten Staaten.
...
Sein Buch ist ... in einer auch für historische
Laien verständlichen Sprache geschrieben. Hoffentlich findet es Leser
auch unter jenen, von denen es handelt: den deutschen Katholiken"
Heinrich August Winkler,
DIE ZEIT
|

[Bestellen] |
Cornwell, John: Pius XII.
Der Papst, der geschwiegen hat. München 2001:
List Verlag.
(Titel der englischen Originalausgabe: Hitler's Pope.
The secret history of Pius XII. London 1999: Penguin)
Er lebte wie ein Heiliger und herrschte wie ein
Diktator. John Cornwell schildert Leben und Pontifikat des Papstes
Pius XII. Dieser führte das Papsttum auf eine seit dem Mittelalter
nicht mehr erreichte Höhe der Macht und des moralischen Ansehens.
Innerhalb der Kirche bekämpfte er jeden Widerspruch. Zwar lehnte er
Hitler ab, aber zur Verfolgung und Vernichtung europäischer Juden
schwieg der Stellvertreter Christi auf Erden. Selbst die Deportation
römischer Juden nahm er widerspruchslos hin. Während sich Europa auf
den Zweiten Weltkrieg zubewegt, wird im März 1939 in Rom ein neuer
Papst gewählt. Die Wahl des Konklaves fällt auf Eugenio Pacelli. Der
Kardinal, der sich fortan Pius XII. nennt, blickt auf eine steile
Karriere als Kirchenmann zurück. Bereits das Konkordat mit dem
Deutschen Reich vom 20. Juli 1933 trägt seine Handschrift. Es
verschaffte dem NS-Regime wertvolle innen- und außenpolitische
Anerkennung. Während des Krieges steuert Pius XII. einen Kurs strikter
Neutralität, selbst dann noch, als sich die Niederlage der
Achsenmächte abzeichnet. Er vermeidet jede klare Verurteilung der
Judenverfolgung, über deren Ausmaß er weitgehend unterrichtet ist.
John Cornwell erzählt die Geschichte eines Papstes,
der sich im Konflikt zwischen Macht und Moral für das Schweigen
entschieden hat und damit für das Einvernehmen mit der Tyrannei - und
letztlich mit der Gewalt.
|
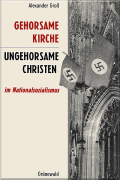
[Bestellen] |
Groß, Alexander: Gehorsame Kirche – Ungehorsame Christen. Mainz
2000: Matthias-Grünewald Verlag.
Der Widerstand katholischer Christen und Christinnen
gegen das NS-Regime entsprang einer Gewissensentscheidung, die in der
Regel im bewußten Gegensatz zur Haltung und zu den Anordnungen der
Kirchenleitung stand, die auf Einvernehmen mit dem Regime und den
Behörden bedacht war. Bei ihrem mutigen Engagement konnten diese
Christen deshalb nicht mit dem Rückhalt ihrer Kirche rechnen.
Alexander Groß, geboren 1931, Sohn des von der
NS-Diktatur ermordeten christlichen Widerstandskämpfers Nikolaus Groß,
arbeitet dieses dunkle Kapitel auf. Er befaßt sich eingehend mit der
realpolitischen Wirkung kirchlichen Verhaltens auf die Außenpolitik
Hitlers, auf den zweiten Weltkrieg sowie auf die Judenverfolgung und
–ermordung, stellt ferner die Distanz zwischen den Zielen der
Kirchenleitung und denen der widerständigen Christen dar und behandelt
den Umgang der Kirche mit diesem Teil der Geschichte nach der
Befreiung vom NS-Regime.
Entschieden wendet sich Groß gegen den Versuch der
Kirchenleitung, die katholischen NS-Opfer für die Kirche zu
vereinnahmen und aus ihrem Glaubenszeugnis im nachhinein einen
"kirchlichen Widerstand" zu konstruieren.
|

[Bestellen] |
Moritz, Stefan: Grüß Gott und Heil Hitler.
Katholische Kirche und Nationalsozialismus in Österreich. Wien,
2002: Picus Verlag.
Während die katholische Kirche Österreichs in der
geschichtlichen Betrachtung der NS-Vergangenheit gern ihre Opferrolle
in den Vordergrund rückt, geht Stefan Moritz der Frage nach, wie sich
die Amtskirche tatsächlich gegenüber dem nationalsozialistischen
Regime verhielt. Er zeigt, wie Bischöfe und Priester zu
Erfüllungsgehilfen des Terrorregimes wurden, wie sie dessen Aufstieg
und Festigung förderten und ihren Einfluss nahezu ausschließlich zur
Sicherung der eigenen Stellung nutzten.
|
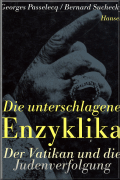
[Bestellen] |
Passelecq, Georges / Bernard Suchecky: Die unterschlagene
Enzyklika. Der Vatikan und die Judenverfolgung. München, Wien
1997: Hanser Verlag.
(Titel der französischen Originalausgabe: L'encyclique
cachée de Pie XI. Une occasion manquée de l'Église face à
l'antisemitisme. Paris 1995: Édition La Découverte)
Im Sommer 1938 gibt Papst Pius XI. den Entwurf einer
Enzyklika über die Einheit des Menschengeschlechts in Auftrag. Sie
soll gegen Rassismus und Antisemitismus protestieren. doch Pius XI.
stirbt. Unter seinem Nachfolger Pius XII. wird die Enzyklika nicht
fertiggestellt, statt dessen: Stillschweigen angesichts der
Judenverfolgung. Bis heute weigert sich der Vatikan, den
Enzyklikaentwurf zu veröffentlichen. Georges Passelecq und Bernard
Suchecky haben in einem amerikanischen Archiv eine Fassung des
Entwurfs entdeckt: Ihr Buch ist ein Stück Aufklärung zum schwer
belasteten Verhältnis zwischen Christen und Juden. |
hagalil.com
05-11-02 |