|
 |

Avi Primor
»...mit
Ausnahme Deutschlands«
Als Botschafter Israels in Bonn
[Bestellen]
|
I. Teil - c
Deutschland – ein weisser Fleck
Als mögliche Ursache meiner Abneigung gegen Deutschland, die mich auch den
neuen, nach dem Krieg gegründeten Staat, die demokratische Bundesrepublik,
nicht wahrnehmen ließ, kam nicht zuletzt die massenhafte Vertreibung und
Ermordung von Juden in Betracht, die Deutschland vor sich selbst und vor der
Weltöffentlichkeit zu verantworten hat. Doch hatte es, wie wir es als Kinder
lernten, nicht schon in früheren Jahrhunderten Judenverfolgungen großen
Ausmaßes gegeben, Haß auf Menschen, die sich zum jüdischen Glauben
bekannten, Pogrome und blindwütige Vernichtungszüge, die zum Tod von
Tausenden und Abertausenden von Juden führten? Bereits vor zweitausend
Jahren, als die Römer uns besiegt und Jerusalem zerstört hatten, sind wir
aus dieser Stadt verbannt und schließlich auch aus unserem Land vertrieben
worden.
Verheerender noch verlief die große Welle der
Judenverfolgungen, die Ende des 11. Jahrhunderts mit den Kreuzzügen
einsetzte. In Spanien hatte der Untergang der Araberstaaten, die
Rückeroberung (Reconquista) des bis dahin arabisch beherrschten Südens und
die Wiederherstellung der christlichen Oberherrschaft 1492 nicht nur die
Vertreibung der nicht-christlichen Mauren zur Folge. Auch die Juden mußten
das Land verlassen, sofern sie als »Ungläubige« sich nicht dem Taufgebot der
Inquisition unterwarfen, wozu sich nur wenige bereit zeigten. Am Hof
geachtet, am kulturellen Leben beteiligt und dank ihres hohen
Bildungsstandes einflußreich, hatten sie glücklich und sozial voll
integriert bis zur Ausweisung mehr als tausend Jahre lang in Spanien gelebt
und das Land als ihre Heimat betrachtet, sowohl unter christlicher wie
muslimischer Herrschaft. Die Juden Spaniens galten in der gesamten Diaspora
als kultivierteste und mit ihren Gastvölkern am stärksten verbundene
Gemeinschaft. Ihre Vertreibung machte sie über Nacht zu Recht- und
Besitzlosen.
Schließlich, als weiteres Beispiel
herausgegriffen aus der langen Leidensgeschichte des jüdischen Volkes, der
Aufstand des ukrainischen Kosakenführers Bogdan Chmelnizkij im
17.Jahrhundert, sein Kampf gegen die Polen und der Anschluß der Ukraine an
Rußland (1654). Im Grunde hatte er, durchaus ehrenwert, nichts anderes im
Sinn, als sein Land von fremder Herrschaft zu befreien. Zur Bilanz seines
Konflikts mit den Polen aber gehört auch die Ausrottung eines Großteils der
jüdischen Bevölkerung. Warum eigentlich und zu wessen Nutzen? Waren schon
damals nach landläufiger Auffassung die Juden »an allem schuld«? Eine Frage,
die an jene bekannte Anekdote erinnert, die genau diese Meinung kolportiert
und außer den Juden auch den Radfahrern die Schuld an allem und jedem
zuweist. »Warum die Radfahrer?« fragt einer. Antwort: »Warum die Juden?«
Solche Geschichten, mehr oder minder
geistreich und oft voll bitterer Ironie, sind undenkbar ohne die gewaltige
Summe der Erfahrungen, die ihnen zugrunde liegt: soziale und rechtliche
Diskriminierungen, etwa die Ausschaltung der Juden aus dem politischen und
öffentlichen Leben, Einschränkungen der Berufs- und Glaubensfreiheit und die
Pflicht, in eigenen Wohnvierteln zu leben, den Ghettos, sodann Heimsuchungen
durch Pogrome bis hin zum staatlich geduldeten oder gar befohlenen Mord.
Mit dem während meiner Ausbildung vertieften
Wissen um die leidvollen Erfahrungen meines Volkes aber kam ich kein Stück
der Antwort auf die Frage näher, weshalb Deutschland für mich lange eine Art
Niemandsland blieb, obwohl sich doch gerade hier Unsägliches ereignet hatte,
nicht erst in jüngerer Vergangenheit. Auch der Krieg, genauer gesagt die
Furcht vor einem Einfall deutscher Truppen in unser Land, der 1941 und im
darauffolgenden Jahr nicht ganz auszuschließen war, hat mein Verhältnis zu
Deutschland, das eigentlich ein Un-Verhältnis war, kaum bestimmt.
Feldmarschall Rommel war mit den Soldaten seines Afrikakorps innerhalb
kurzer Zeit zwar weit nach Osten vorgedrungen, so daß man bei uns schon
Vorbereitungen zum Widerstand traf und von Städten sprach, die wie Festungen
verteidigt werden sollten, mit Sprengsätzen für die Häuser und bis zum
letzten Mann, falls die Invasoren tatsächlich eindringen und die Engländer
sich zurückziehen und uns, wie vermutet, im Stich lassen würden. Die
anfängliche Besorgnis schlug mehr und mehr in ein Gefühl ohnmächtiger
Beklommenheit um.
Nur: Von all dem spürte und wußte ich so gut
wie nichts. Ich war damals gerade erst sieben, meine bis dahin normal
verlaufene, ja ausgesprochen glückliche Kindheit wurde von den Sorgen der
Erwachsenen nicht belastet, schon gar nicht durch Schreckensnachrichten. Das
erste, was ich über Rommel erfuhr, verband sich, ohne daß ich es ganz
verstand, mit dem Namen Bir-Hakeim, dem Schauplatz jener Schlacht, in der es
der Freien Französischen Armee de Gaulles unter ihrem Befehlshaber General
Pierre Koenig gelang, das Afrikakorps sechzehn Tage aufzuhalten und damit
den Engländern hinreichend Zeit für ihren Aufmarsch bei El Alamein zu
verschaffen. Auch der Name dieser Oase in der Libyschen Wüste blieb mir seit
jener Zeit im Gedächtnis, bedeutete er doch gleichsam das Ende aller
Bedrohung: Die Niederlage des Afrikakorps in der Schlacht bei El Alamein
besiegelte das Schicksal des deutschen Expeditionsheers in Nordafrika und
leitete dessen Rückzug nach Italien ein. Danach reihte sich eine
Siegesmeldung an die andere.
Kindheitsängste vor deutscher Kriegsgewalt
also haben, da ich sie nicht erlebte, mein früheres Deutschlandbild mit
Sicherheit nicht beeinflußt. Wohl aber kehrte die Erinnerung an jene Jahre
zurück, als ich, inzwischen Botschafter in Bonn, Manfred Rommel
kennenlernte, den Sohn jenes umstrittenen Feldherrn, der nach dem
Afrikakorps später eine Heeresgruppe an der Westfront befehligte. Ich
schätze Manfred Rommel, den langjährigen Oberbürgermeister Stuttgarts, als
aufrichtigen Freund Israels, der 1987 als »Guardian of Jerusalem«
ausgezeichnet worden ist und sich ebenso um die deutsch-französischen
Beziehungen wie um die demokratische Erziehung der Nachkriegsjugend verdient
gemacht hat. Das erste Mal sah ich ihn im Juni 1994 in einem
Fernseh-Interview. Die Sendung war anläßlich des 50. Jahrestags der Invasion
der Alliierten in der Normandie aufgezeichnet worden, bot aber nicht nur
Gelegenheit zu kriegsgeschichtlichen Rückblicken. Zu den Erinnerungen an den
berühmten Vater, die Rommel in diesem Interview preisgab, gehörte, daß er,
der Sohn, bereits als Fünfzehnjähriger eine Luftwaffenuniform getragen, die
SS der Luftwaffe damals jedoch entschieden vorgezogen habe. Daß man ihn
nicht zum Dienst in der SS einzog, habe er allein seinem Vater zu danken.
Später, in einem Gespräch, konnte ich Manfred
Rommel zu diesem Punkt näher befragen. Er bestätigte, daß er, fast noch ein
Kind und indoktriniert durch Erziehung und Nazi-Propaganda, sich für die SS
begeistert hatte, nicht zuletzt auch deshalb, weil die SS so schneidige
Uniformen trug ... Als er sich aber dann ernstlich als Freiwilliger um
Aufnahme bemühte und seinem Vater den Antrag zur Unterschrift vorlegte, die
wegen der Minderjährigkeit des Bewerbers erforderlich war, zerstoben alle
vermeintlich schönen Pläne: Nicht nur, daß der Feldmarschall die
Unterschrift verweigerte, er deutete seinem Sohn gegenüber auch an, als
SS-Mann müsse er bereit sein, Menschen zu vergasen. An dieser Stelle des
Gesprächs überkam mich eine seltsam beunruhigende Vorstellung, absurd und
doch so abwegig nicht: Was wäre aus unserem Land, was wäre aus mir geworden,
hätten 1942 die Divisionen des Afrikakorps die Schlacht von El Alamein nicht
verloren? Nichts hätte sie nach den voraufgegangenen Erfolgen daran hindern
können, den Weg nach Palästina einzuschlagen. Und ich, kaum acht Jahre alt,
hätte mein Leben womöglich in einer Gaskammer beendet.
Deutschland also als einziger Inbegriff und
Verkörperung des Bösen schlechthin? Mich hat es nicht nachhaltig
beeindruckt. Schon während des Kriegs gab es nicht wenige Menschen im
heutigen Israel, die sich, neben der am Anfang nicht ganz unbegründeten
Furcht vor einem dauerhaften Sieg Nazi-Deutschlands über alle mittel- und
osteuropäischen Staaten, mit dem Vorgefühl des Entsetzens die Begegnung mit
einer ungefähr ähnlich totalitären Ideologie ausmalten, wie sie der
Nationalsozialismus darstellte.
Mein Großvater väterlicherseits etwa, der am
Anfang des Jahrhunderts mit seiner Familie vor den Pogromen in der Ukraine
nach Holland geflüchtet war, bevor er schließlich in Palästina eine neue
Heimat fand, wurde, zumal gegen Ende des Krieges, nicht müde, vor den
Gefahren des Kommunismus zu warnen. Es war bald nach der Schlacht von El
Alamein, als ich ihn fragte, ob »die Bösen« nun endgültig besiegt seien. Die
Antwort fiel weniger eindeutig aus, als ich es nach meinem damaligen
Verständnis der Dinge erwartete. Nicht allein die Nazis seien »böse«, wurde
mir erklärt. »Hast du schon mal von den Kommunisten gehört?« Als ich
verneinte, erhielt ich einen Nachhilfeunterricht besonderer Art: Die
Kommunisten würden auch als »Rote« bezeichnet, denn Rot sei die Farbe ihrer
Fahnen, rot sei bekanntlich aber auch das Blut. Folglich handele es sich um
blutrünstige, auf jeden Fall gefährliche Leute, welche ihre in der Farbe
symbolisierten Absichten und Ziele sogar noch schamlos zur Schau trügen.
Meine Mutter, die ins Zimmer getreten war, unterbrach die Belehrung abrupt.
Sie widersprach ihr aber nicht, wich dem wegen der Zurechtweisung empörten
Großvater vielmehr mit der schwer zu widerlegenden Feststellung aus, es gebe
weiß Gott größere Sorgen und tiefere Ängste als die Furcht vor den
Kommunisten.   Nächster Teil
Nächster Teil
  Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Erschienen 1997 beim Ullstein-Verlag, Berlin
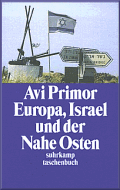


|