Helene
Seidler lebt seit mehr als zwanzig
Jahren in Jerusalem, wo sie als
Übersetzerin hebräischer Literatur ins
Deutsche tätig ist, unter anderem für
die bekannte israelische Autorin Batya
Gur, den Psychotherapeuten Joram Jowel,
die palästinensische Schriftstellerin
und Malerin Aida Nasrallah.
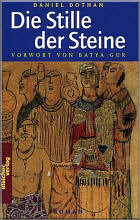 Ihr
erstes übersetztes Werk war "Die Stille
der Steine", Daniel Dothans Suche nach
Israels kulturellen Wurzeln in Europa.
Ihren ersten eigenen Roman - "Das Meer
vor meiner Tür", begann Helene, als sie
in der Zeitung der "heillosen Heiligen
Stadt" las, dass man Bobby Hatfield. den
dreiundsechzigjährigen Tenor des Duos
"The Righteous Brothers", vierzig
Minuten vor einem Konzert in Michigan
tot in seinem Hotelbett aufgefunden
hatte. Sein Partner erlitt einen Schock,
Helene starrte lange auf die lapidaren
Zeilen, und alles war wieder da: "Die
unbestimmte Verheißung, die der
Soulgesang der beiden vor vierzig Jahren
in mir ausgelöst hatte. Das triste
Wohnzimmer, in dem ich damals heimlich
vor dem Fernseher saß. Der weitläufige
Garten hinter dem drei-flügeligen
Fenster. Unser windumbraustes
Backsteinhaus. Ihr
erstes übersetztes Werk war "Die Stille
der Steine", Daniel Dothans Suche nach
Israels kulturellen Wurzeln in Europa.
Ihren ersten eigenen Roman - "Das Meer
vor meiner Tür", begann Helene, als sie
in der Zeitung der "heillosen Heiligen
Stadt" las, dass man Bobby Hatfield. den
dreiundsechzigjährigen Tenor des Duos
"The Righteous Brothers", vierzig
Minuten vor einem Konzert in Michigan
tot in seinem Hotelbett aufgefunden
hatte. Sein Partner erlitt einen Schock,
Helene starrte lange auf die lapidaren
Zeilen, und alles war wieder da: "Die
unbestimmte Verheißung, die der
Soulgesang der beiden vor vierzig Jahren
in mir ausgelöst hatte. Das triste
Wohnzimmer, in dem ich damals heimlich
vor dem Fernseher saß. Der weitläufige
Garten hinter dem drei-flügeligen
Fenster. Unser windumbraustes
Backsteinhaus.
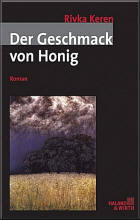 Wenig
später erkundigte sich Rivka Keren, eine
wunderbare Autorin, der ich während der
Übersetzung ihrer Romane sehr nahe
gekommen war, in einem Brief nach meiner
Kindheit. Riwi. Riwi, du weißt nicht,
was du mir antust!"... Wenig
später erkundigte sich Rivka Keren, eine
wunderbare Autorin, der ich während der
Übersetzung ihrer Romane sehr nahe
gekommen war, in einem Brief nach meiner
Kindheit. Riwi. Riwi, du weißt nicht,
was du mir antust!"...
Danach vergingen
nur noch einige Tage, bevor sie in ihrer
sonnigen Terrassenwohnung, auf eine
Trittleiter stieg und die Bodenklappe
öffnete: "Zwischen zerschlissenen
Wolldecken, zu klein gewordenen
Rollschuhstiefeln und zerbrochenen
Bilderrahmen fand sich das
Weidenköfferchen. in dem ich meine
deutsche Vergangenheit aufbewahre"...
Helene Seidler, im Roman "Klärchen", kam
1948 in Deutschland zur Welt und wuchs
in einem kleinen Dorf in
Schleswig-Holstein auf. In Hamburg
studierte sie Pädagogik und Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft.
"Die Wellen des Meeres bergen in sich
die gewaltige Kraft der Veränderung. Sie
packen uns, reißen mit. nehmen uns auf
in ihren Spannungsbogen zwischen der
großen, todbringenden Nordsee im Krieg
und Nachkriegsdeutschland der
Bundesrepublik bis hin zum heißen,
heilenden Salzmeer Israels, in die
Gegenwart. Ihre Schilderungen sind
frappierend offen, dramatisch, teilweise
pointiert witzig, psychologisch und
zugleich dokumentarisch. Sie lassen vor
uns Erinnerungen an eine schicksalhafte
Kindheit und Jugend, die Suche nach
Identität jenseits der geographischen
Heimat und subjektiv empfundene Erlösung
entstehen" schreibt Marie-Louise Jung in
einer Rezension.
Helene Seidler hat zwei Töchter. Sophie,
die ältere, beendete soeben ihren
Militärdienst in Israel. Scharon, die
jüngere, ist zur Zeit Schülerin am
Hebräischen Gymnasium. Ihr Roman
erschien im Roman Kovar Verlag.

Lektorat: Marie-Louise
Jung, Umschlaggestaltung: Adams Grafik,
Fotosatz: Vita Stolbunsky, Jerusalem,
Israel, Druck und Bindung: tHB,
Tschechische Republik, Internet:
www.kovar-verlag.com
ISBN 978-3-86577-105-6
http://astore.amazon.de/buchundjudenhaga/detail/386577105X
Einsame Lippen:
Der Beginn einer Übersetzerkarriere
Aus Helene Seidlers
"Das Meer vor meiner Tür"
Vier von Raphaels
Schwestern wohnten in der näheren
Umgebung, zwei lebten in Los Angeles den
amerikanischen Traum; jede war auf ihre
Art eine beeindruckende, orientalische
Schönheit.
Sie arbeiteten als Verkäuferin.
Friseurin oder Gehilfin im Kindergarten
und besuchten uns an Festtagen
gelegentlich mit ihren Familien. Ima
Rachel (Anm.: die Schwiegermutter)
bereitete für diese Gelegenheiten scharf
gewürzte marokkanische Gerichte zu,
geschmorte Auberginen, stundenlang
geköchelte Paprikasauce mit Tomaten und
Koriander, Zungen-Olivenragout,
Lammrücken mit Rosmarin. Alle halfen,
die dampfenden Kochtöpfe vier Treppen
hinaufzuschleppen.
War das reichhaltige Mahl von
Schabbatgesängen begleitet verzehrt und
der Abwasch routiniert erledigt, aalten
meine Schwägerinnen sich zwanglos auf
allen verfügbaren Sesseln, Sofas und
Betten, dösten in abgedunkelten Zimmern,
ließen sich von ihren Kindern genüsslich
Rücken. Arme und Beine massieren,
erlaubten meinen Mädchen, ihnen Zöpfe in
die dunklen Mähnen zu flechten und
unterhielten sich gegenseitig mit
harmlosem Geplauder über Kleider, Kinder
und andere Verwandte. Dann war unsere
Wohnung mit Lachen erfüllt, mit
weiblicher Intimität. Es mangelte auch
ihnen nicht an Sorgen; doch am Schabbat
hielten sie sich an das Gebot, allen
Kummer beiseite zu schieben.
Meine Töchter lernten bei den Tanten und
ihrer Großmutter Rachel kreatürliche
Wärme und vorbehaltloses Wohlbehagen
kennen, das außerhalb meiner eigenen
emotionalen Bandbreite lag. Ich war und
bin diesen großherzigen Wesen zutiefst
dankbar. Machten sie sich aber in meinem
Territorium breit, fühlte ich mich
gestört, hatte an Wut zu würgen und war
erleichtert, wenn sie sich
verabschiedeten. Die keifende Stimme in
mir. die mich selbst unbarmherzig
kritisierte, fand auch an Raphaels
Verwandtschaft vieles befremdlich.
Möglicherweise neidete ich ihnen auch
die angeborene, wie selbstverständlich
getragene Schönheit.
Am Morgen nach der Pyjamaparty zu
Sophies zehntem Geburtstag tummelten
sich fünfzehn muntere Möpse in der
Morgensonne auf unserer Terrasse. Unsere
Fünfjährige bestrich, außer sich vor
Begeisterung. Pfannkuchen mit Nutella
für die Freundinnen ihrer großen
Schwester. Ich verließ die Wohnung in
namenlosem Groll und ging, vor mich hin
schimpfend, in das nahe gelegene
Wäldchen. Ich hinterfragte den Groll
nicht, ich hatte mich an sein
plötzliches Auftreten gewöhnt und
wusste, dass er nach einem Spaziergang
meistens wieder abklang. Was ich
verdrängte, haben meine Töchter mit
ihren feinen Antennen gespürt. Ima, was
hast du? Warum sprichst du nicht mit den
anderen? Warum bist du so ernst?
In den Wochen nach dem Besuch bei Dr.
Holtzman kam ich meinem Schatten
allmählich auf die Schliche. Ich musste
ihn wohl oder übel als Teil von mir
akzeptieren. Leicht fiel es mir nicht.
Ich war
achtundvierzig, die Wechseljahre plagten
mich mit heißen Schauern und wachsender
Gereiztheit.
"Wenn du dich nicht auf eine
Therapie einlassen willst, nimm
wenigstens Fluoxetin", riet mir mein
Frauenarzt, nachdem ich ihm erzählte,
was Mutter sich in ihrem
achtundvierzigsten Jahr angetan hatte.
"Flutin ist in unserem Land die
begehrteste Medizin." Ich hole mir
seitdem alle drei Monate ein Rezept bei
ihm und halte den Kopf über Wasser.
War da noch unerlöste Wut am Werk, oder
war es schon die zuträgliche Wirkung des
Medikaments, dass ich nach einer
Unstimmigkeit mit meinem Vorgesetzten
das Büro der Stiftung, in das ich sieben
Jahre lang jeden Morgen gestrebt war,
schnurstracks verließ und nie
zurückkehrte? Der Ordnung halber reichte
ich eine vordatierte Kündigung nach.
Die Frage, was ich nun mit den freien
Morgen anfangen sollte, stellte sich
nicht. Ich folgte einer Eingebung, griff
nach dem ersten hebräischen Roman, der
mir in die Hand fiel, und machte mich an
die Übersetzung der Anfangsseiten. Ich
wunderte mich ein wenig, wie gut der
Text herauskam, und wie er sich durch
vielmaliges Lesen und Bearbeiten immer
weiter verbessern ließ. Als sich ein
schimmernder Wortteppich über zehn
Seiten zog, faxte ich sie als
Probeübersetzung an einige deutsche
Verlage und stellte mich als
Literaturübersetzerin vor.
Der Lektor eines namhaften Verlags
schrieb mir, er würde meine Unterlagen
zu seinen Akten nehmen. Seine
schwungvolle Unterschrift wies ihn als
Intellektuellen aus, der auch einmal ein
Wagnis eingeht. "Bitte lassen Sie sie
dort nicht verstauben", schrieb ich
rasch zurück. Wenig später bat er um
eine Probeübersetzung für ein Buch des
Tel Aviver Musikers und Autors Daniel
Dothan. Ich ließ alles stehen und liegen
und machte mich sofort an die Arbeit.
Der Text, ein geschickt zusammengefügtes
literarisch-historisches Mosaik, erzählt
vom Leben europäischer Künstler in
Palästina. Als ich sah, dass es auch
Episoden aus dem Leben der Else
Lasker-Schüler enthielt, ahnte ich, es
sei für mich bestimmt. Nach dem
Abschicken der Arbeitsprobe zog ich mich
weiterhin jeden Tag mit dem
"dokumentarischen Roman" zurück. Eine
tiefe, nie gekannte Genugtuung erfüllte
mich. Klärchen, endlich eine Tätigkeit,
die dir entspricht. Manchmal kamen mir
die Tränen vor Glück.
Der Text belohnte jede Suche nach dem
richtigen Wort, nach dem passenden
Satzgefüge mit einer neuen Einsicht, mit
tieferem Verständnis für die menschliche
Psyche. Ich erkannte die magische Kraft
meiner Muttersprache, sie muss ein Teil
des Göttlichen in uns sein.
Jahrzehntelang nicht benutzte Wendungen
leuchteten aus dem Gewebe der
Möglichkeiten auf und boten sich mir
inmitten eines Schwalls von Erinnerungen
dar. Von wem hatte ich sie zum ersten
Mal gehört, in welchem Text waren sie
mir begegnet? Mit dem monströsen
Ausdruck "der innere Schweinehund" hatte
Mutter mich manchmal erschreckt. Jetzt
konnte ich ihn im Monolog einer
zerrissenen, mit sich selbst
zerstrittenen Figur verwenden. Als der
Name Jack London auftauchte, fiel mir
ein, wie oft Gabriel seine Bewunderung
für den kühnen Abenteurer geäußert
hatte, nicht von ungefähr. Ich benutzte
das Wort Selbstabschaffungspläne, das
ich vor langer Zeit in einem Brief von
Thomas Mann an Heinrich gelesen und
nicht wieder vergessen hatte (auch er?).
Würde ein Leser erkennen, woher es
stammte? Mit Rilke im Kopf konnte ich
den Satz schreiben: "Doch Sascha gab
Else nicht einmal ein Zeichen; nirgends
fiel ein Blatt, auch der Wind schwieg."
Die Sprache brachte mir meine Geschichte
zurück. Wort für Wort half mir
verstehen, woher ich kam und welchen Weg
ich gegangen war.
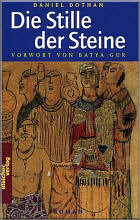 Als
der Verlag mir schrieb, dass man meine
Probeübersetzung unter einigen anderen
ausgewählt hatte, war ich nicht
überrascht. Ich hatte inzwischen schon
fast ein Drittel geschafft. Das Buch
erhielt im Deutschen den Titel "Die
Stille der Steine"; unsere
berühmte Batya Gur schrieb ein Nachwort;
auf seinem Einband prangt eine
Lasker-Schüler-Zeichnung aus Dothans
Privatbesitz. Das selten schöne Produkt
wurde verramscht, als der Verlag vor
einigen Jahren seine Pforten schloss.
Wer Glück hat, kann es für einen Euro
neunzig auf einem Wühltisch finden und
dort von der Begegnung der beiden
hebräischen Autoren Abraham Ben-Jitzchak
und Josef Brenner nachlesen: Als
der Verlag mir schrieb, dass man meine
Probeübersetzung unter einigen anderen
ausgewählt hatte, war ich nicht
überrascht. Ich hatte inzwischen schon
fast ein Drittel geschafft. Das Buch
erhielt im Deutschen den Titel "Die
Stille der Steine"; unsere
berühmte Batya Gur schrieb ein Nachwort;
auf seinem Einband prangt eine
Lasker-Schüler-Zeichnung aus Dothans
Privatbesitz. Das selten schöne Produkt
wurde verramscht, als der Verlag vor
einigen Jahren seine Pforten schloss.
Wer Glück hat, kann es für einen Euro
neunzig auf einem Wühltisch finden und
dort von der Begegnung der beiden
hebräischen Autoren Abraham Ben-Jitzchak
und Josef Brenner nachlesen:
"Sie saßen da und schwiegen, zwei
verbundene Gefäße, zwei Geschöpfe aus
einer anderen Welt. Einer nahm das Wesen
des anderen in sich auf, beide strömten
ineinander. Abraham Ben-Jitzchak war
nicht versucht, sich der menschlichen
Sprache zu bedienen, die er so
vollkommen beherrschte. Brenner dachte
nicht daran, den Herausgeber
hervorzukehren. ... In dieser Nacht
weinte Brenner und schrie. Nie zuvor
hatten die Nachbarn ein solches
Wehklagen von ihm gehört. Er weinte um
sich und um Ben-Jitzchak und um alle
anderen, die wohl für einen Moment
glücklich sind, sonst aber ihr Leben
unter Schmerzen hinbringen. Endlich
schlief er draußen unter dem jungen
Olivenbaum ein."
Seit vier Jahren wohne
ich mit meinen Töchtern in der nach
Josef Chaim Brenner (1881-1921,
Hebräischer Autor, Übersetzer.
Redakteur) benannten Brennerstraße. Er
wurde vierzigjährig von arabischen
Terroristen ermordet. "Nackt und kalt
lag Brenners Leichnam auf der Erde. Noch
bevor Menschen ihn fanden, bedeckte der
Wind ihn mit Laub. Die verkrampfte Faust
über dem Herzen hielt handbeschriebene
Blätter. Wer von seinen Mördern wusste,
dass er Schriftsteller war? ... Araber
fällen Juden, Juden fällen Araber."
Dothans Buch machte mich mit den
Gedichten vertraut, auf denen allein
Abraham Ben-Jitzchaks Ruhm beruht. Das
aus Wien nach Jerusalem vertriebene
Genie meinte, auf der Welt nur eine
Aufgabe zu haben: zwölf geheimnisvolle
Gedichte zu schreiben.
Einsame Lippen
Tag erbt vom
Vortag den Untergang
Sommer um Sommer vergeht im Herbst
Nacht bricht um Nacht aus in
Klagegesang
Die Welt schreit immerzu vor
Schmerz.
Und morgen werden wir wortlos
sterben
Stehen wie anfangs vor
verschlossenem Tor
Jubelnd erwartet die Seele den
Ewigen
Spürt sein Erbarmen - und erschauert
davor.
Ein Tag reicht dem anderen die
glühende Sonne
Jede Nacht gießt erneut ihre Sterne
aus
Einsame Lippen verstummen: auf
sieben Pfaden
Verloren wir uns, nur einer führt
nach Haus.
Nachdem das vollbracht
war. versank er im Meer des Schweigens.
Eine Einsicht des Dichters traf mich wie
der Blitz. Staunend und mit Herzklopfen
probierte ich verschiedene deutsche
Versionen aus. Nachdem ich eine Nacht
darüber geschlafen hatte, lautete die
endgültige Fassung: "Denn es zählte
nicht wirklich, wie viele Bücher einer
schrieb, wie viele Lieder er
komponierte, wie viele Länder er
entdeckte -wichtig war allein die
Verbindung zum Absoluten." Nun war mir
doch noch zugetragen worden, wonach ich
seit meiner Kindheit auf Tausenden von
Buchseiten gesucht hatte: ein Satz, der
den Sinn des Lebens enthielt.






Epilog
An einem klaren
Jerusalemer Wintermorgen, es ist der 29.
Januar 2004, sitze ich grübelnd an
meinem Schreibtisch. Meine beiden
Töchter haben gerade mit leichter
Verspätung die Wohnung verlassen und
sind auf dem Weg ins Hebräische
Gymnasium, die renommierte, von
deutsch-jüdischen Intellektuellen in den
zwanziger Jahren gegründete Oberschule.
Wir sind hier vor vier Jahren
eingezogen, nach der Trennung von
Raphael. Mein Vermieter erzählte mir,
dass Gerschom Scholem, der bekannte
Erforscher der jüdischen Mystik, in
diesen Räumen gelegentlich zu Gast
gewesen sei. Für mich ist er immer noch
da. Die knallrote, am ersten Tag meiner
Ankunft in Jerusalem erworbene
Taschenbuchausgabe seiner Major Trends
in Jewish Mysticism steht zerlesen in
meinem weißen Regal. Das Haus, in dem
Martin Buber eine Zeitlang wohnte, ist
nur fünfzig Schritte entfernt. An
manchen Morgen begrüße ich den schwarzen
Holzbriefkasten, auf dem Wissende seinen
Namen noch entziffern können. Der
charaktervolle arabische Bau wird
zurzeit bis auf die Fassade entkernt und
renoviert.
Ein lauter Knall, die Fensterscheiben
klirren, ich fahre auf. Ich weiß seit
längerem zwischen einem F-16 Jäger, der
versehentlich über der Stadt die
Schallgrenze durchbricht, und der
Explosion einer Bombe zu unterscheiden.
Das eben war das besonders grausige,
weil durch Körper aus Fleisch und Blut
gedämpfte Dröhnen einer starken
Explosion. Zum zweiten Mal ist ein
Selbstmordattentäter der Residenz des
Ministerpräsidenten erschreckend nahe
gekommen. Und wir wohnen gleich um die
Ecke.
Meine beiden Mädchen waren nur noch ein
paar Schritte von der Kreuzung entfernt,
an der es passierte. Auch sie sahen
Hände vom Himmel fallen, wie Zeruya
Shalev, die Schriftstellerin, die einige
Meter vor ihnen verletzt zusammenbrach
aus dem Krankenhaus ihre Erinnerung für
einen deutschen Radiosender beschrieb.
"Ima, pigua", - Mutti, ein Attentat -,
meldete Sophie mir weinend durchs Handy.
"Uns ist nichts passiert, aber wir
können den brennenden Autobus sehen.
Halbe Menschen hängen aus den Fenstern.
Die Gaza-Straße ist voller Blut." Ich
trug ihr auf, ihre Schwester an die Hand
zu nehmen und sich so rasch wie möglich
zu entfernen. Dann hörte ich die Sirenen
der Rettungsdienste und der Polizei
heulen und machte mich benommen auf den
Weg, um die Bilder aus dem Fernsehen in
Wirklichkeit zu erblicken. Die sonst
ruhige Brenner-Straße war voller
kreischender Ambulanzen, Sanitäter
stürzten heraus, Polizisten streiften
sich noch im Rennen gelbe Westen über.
Sie sperrten die Unglücksstelle ab. Der
Anblick dessen, was Sophie mir
beschrieben hatte, blieb mir erspart.
Sophie sollte an diesem Tag ihre
Abiturarbeit in Bibelkunde schreiben.
Man bot ihr Zusatzzeit an, damit sie
sich beruhigen konnte. Sie kam nach zwei
Stunden haltlos weinend heim. Scharon,
meine jüngere Tochter, verlor vor
anderthalb Jahren eine Klassenkameradin
bei dem Busattentat in Gilo. Zunächst
hatten die Kinder gehofft, Galila hätte
sich nur verspätet. Aber sie kam nicht
und ist dann nie mehr gekommen. Scharon
ist seitdem ängstlich und verstört. Im
Gymnasium wurde sie gleich von einer
Psychologin betreut. Die Schulbehörde
hatte das Notfallteam schon geschickt.
Im Neunzehner, der explodiert war, saß
nur ein Schüler des Gymnasiums; er kam
mit Brandwunden davon. Zehn seiner
Mitfahrer wurden getötet, mehr als
fünfzig Menschen verletzt, darunter auch
viele Passanten.
Drei Wochen später heulen morgens wieder
die Sirenen. Diesmal hat ein
Selbstmörderattentäter die Linie 14
gewählt, die Schüler aus den
südöstlichen Stadtteilen ins Gymnasium
fährt. Metallsplitter zerreißen Lior
Asulai, einem fußballbegeisterten
Achtzehnjährigen aus Sophies
Freundeskreis, die Kehle. Das
Bürgerkundebuch aus seinem Rucksack fand
man blutverschmiert auf dem Asphalt. In
seinem Schoß lag die aufgeschlagene
Bibel. Liors Körper wird am Tag darauf
in Anwesenheit des Bürgermeisters und
eines Ministers begraben. Die Schreie
der verwaisten Mutter gellen mir noch in
den Ohren.
Sieben weitere Schüler liegen mit
fehlenden Gliedmaßen oder schweren
inneren Verletzungen im Krankenhaus.
"Das Hebräische Gymnasium weint",
verkünden am nächsten Morgen dicke,
schwarze Schlagzeilen. Statt in ihre
Klassen strömen die Primaner fassungslos
an die Betten ihrer verstümmelten
Freunde und an das Grab von Lior.
Ich bin im Land der Väter und der Kriege
gelandet. Mein Herz blutet, es lebt. |