Das Schtetl
Wirtschaftliche und soziale Strukturen
der ostjüdischen Lebensweise
Andrea Ehrlich
Teil II
-
Einleitung
-
Zur Bedeutung des
Begriffs "Ostjude"
-
Der historische
Hintergrund
-
Das Schtetl
- 4.1.
Definition
- 4.2.
Das äußere Bild des
Schtetlech
-
4.3.
Die wirtschaftliche
Situation
- 4.4.
Soziale Strukturen im
Schtetl
- 4.5.
Der Chassidismus
als religiöses Empfinden im
Schtetl
-
Kriminalität der Ostjuden
-
Schlußgedanke
-
Verwendete Literatur
2) Zur
Bedeutung des Begriffs 'Ostjude'
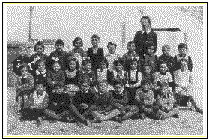 Der
Begriff `Ostjude´ wird heute in der
Wissenschaft völlig
selbstverständlich benutzt, nur
wenige Autoren definieren diesen
Ausdruck. Was gemeint ist, scheint
klar zu sein, Juden aus dem
osteuropäischen Raum. Tatsächlich
birgt der Begriff eine gewisse
Problematik in sich, so daß er nicht
ohne vorhergehende Definition
erscheinen sollte. Der
Begriff `Ostjude´ wird heute in der
Wissenschaft völlig
selbstverständlich benutzt, nur
wenige Autoren definieren diesen
Ausdruck. Was gemeint ist, scheint
klar zu sein, Juden aus dem
osteuropäischen Raum. Tatsächlich
birgt der Begriff eine gewisse
Problematik in sich, so daß er nicht
ohne vorhergehende Definition
erscheinen sollte.
Die Bezeichnung
`Ostjude´ tauchte erst Ende des 19.
Jahrhunderts auf, also etwa 900
Jahre nach den ersten jüdischen
Siedlungen in Osteuropa. Vorher
sprach man von `polnischen Juden´,
was aber aufgrund der polnischen
Teilungen nicht mehr konkret genug
ist. Der Ausdruck ist außerdem eine
rein geographische Bestimmung. Im
Laufe der Jahrhunderte hatten sich
die Juden in Osteuropa zu einer
Einheit im kulturellen Sinne
entwickelt. Heiko Haumann spricht
von der Formung des "Typus des
Ostjuden als in sich abgeschlossene
Kulturpersönlichkeit" während
des 18. Jahrhunderts. So hatten die
Juden, ob sie nun in Polen oder
Weißrußland, in der Ukraine oder in
den tschechischen Ländern lebten,
mehr als nur ihre Religion
gemeinsam. Sie waren durch ihre
eigene Sprache, das Jiddisch, das
bis zum Holocaust sogar zu den
sieben Weltsprachen gerechnet wurde,
ihr eigenes religiöses Empfinden,
den Chassidismus, ihr eigenes
Aussehen und Schönheitsideal und
ihre eigene Kultur und Lebensweise,
das Schtetl, verbunden.
Mit der Zeit
entwickelten sich auch
unterschiedliche Stereotypen von
westeuropäischen Juden und Ostjuden.
Letztere werden im allgemeinen mit
geringer Assimilation und orthodoxer
Religiosität in Verbindung gebracht.
Während im Westen der Großteil der
Juden zum Bürgertum aufgestiegen
war, gehörten die Ostjuden weiter
der Unterschicht oder der niederen
Mittelschicht an. Die Geburtenrate
war dort hoch, die Mischehenrate
sehr gering. Die klassisch
ökonomische Stellung war die des
Mittlers zwischen Stadt und Land.
Die jüdische Aufklärung, die
Haskala, setzte hier sehr spät und
zögerlich ein. Das Stereotyp des
Ostjuden hatte damit im Westen einen
eindeutig negativen Beiklang
bekommen, zumal man fürchtete, die
unzivilisierten Ostjuden könnten die
eigene Assimilation gefährden. Ein
Reisebericht Heinrich Heines aus dem
Jahr 1822 verdeutlicht sehr
anschaulich die Ansichten der
aufgeklärten Westeuropäer: "Das
Äußere des polnischen Juden ist
schrecklich. (...) Dennoch wurde der
Ekel bald verdrängt von Mitleid,
nachdem ich den Zustand dieser
Menschen näher betrachtete und die
schweinestallartigen Löcher sah,
worin sie wohnen, mauscheln, beten,
schachern und - elend sind. (...)
Dennoch, trotz der barbarischen
Pelzmütze, die seinen Kopf bedeckt,
und der noch barbarischeren Ideen,
die denselben füllen, schätze ich
den polnischen Juden weit höher als
so manchen deutschen Juden, der
seinen Bolivar auf dem Kopf, und
seinen Jean Paul im Kopfe trägt. In
der schroffen Abgeschlossenheit
wurde der Charakter des polnischen
Juden ein Ganzes; durch das Einatmen
toleranter Luft bekam dieser
Charakter den Stempel der Freiheit."
Heine zeigt zwar seine Bewunderung
für die Lebensweise der Ostjuden,
aber das oben erwähnte Stereotyp
wurde sehr deutlich gezeichnet: das
Bild des schmutzigen, ewig betenden
und ständig handelnden orthodoxen
Juden. Man muß auch bedenken, daß
Heine seine Bewunderung in einer
Zeit ausdrückt, als die Auswanderung
der Ostjuden nach Westen noch nicht
in umfangreichen Rahmen stattfand
und somit auch noch keine Bedrohung
für die Lebensweise der deutschen
Juden darstellte.
Das Ostjudentum
bildete in jedem Fall die
zahlreichste, abgeschlossenste und
kulturell einheitlichste jüdische
Gemeinde in Europa.
3) Der
historische Hintergrund
Jüdische Kaufleute
siedelten bereits seit dem 9.
Jahrhundert in Polen und Böhmen.
Bedeutung erhielten diese Siedlungen
allerdings erst nach den großen
Masseneinwanderungen aus dem Westen.
Die ersten Migrationswellen begannen
mit dem Wüten der Kreuzfahrer, die
mit der Bekämpfung der
Christusmörder schon vor der Abfahrt
begannen und der großen Pestwelle
von 1348/49, für die die Juden als
Schuldige bestimmt wurden. Über eine
Immigration von Osten her gibt es
nicht genug erforschte Quellen, so
daß man bis heute dazu keine
gesicherte Aussage machen kann. Die
Juden Osteuropas waren somit
großenteils aschkenasischer
Abstammung.
In Polen, ein
Land, das keine eigenständige
Mittelschicht besaß, wurden die
Juden von den Fürsten gerne
aufgenommen, da sie als günstiger
wirtschaftlicher Faktor angesehen
wurden, der das Bürgertum ersetzen
und die Entwicklung der Städte und
des Handels vorantreiben könne.
Boleslaw der Fromme erließ 1264 ein
Statut, das die Juden als
Kammerknechte des Herrschers unter
seinen persönlichen Schutz stellte.
Das Privileg umfaßte die Freiheit
des Handels mit allen Waren, ebenso
wurde den Juden der Geldverleih und
Grunderwerb gestattet. Dieses Statut
blieb bis zu den polnischen
Teilungen Grundlage der jüdischen
Rechtsposition. Auch der Druck der
katholischen Klerus konnte die
Fürsten von ihrer Einstellung zu den
Juden nicht abbringen. Wichtiger
Verbündete der Kirche war das
deutsche Bürgertum in Polen, das die
jüdische Konkurrenz fürchtete und
die eigene wirtschaftliche Stellung
durch zahlreiche Pogrome und
Ritualmordbeschuldigungen zu
behaupten versuchte.
In der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es
erneut zu großen Vertreibungen aus
dem Westen, vor allem infolge der
spanische Inquisition. Die jüdische
Ansiedlung innerhalb Polens schritt
von Westen nach Osten voran.
1483 erlangte
Warschau das Privileg "de non
tolerandis Judaeis". Überall dort,
wo die Juden vertrieben wurden,
versuchten sie in unmittelbarer Nähe
zu siedeln, um weiterhin in den
Städten handeln zu können. So
entstanden neben nichtjüdischen
Großstädten oft jüdische
Kleinstädte, wie beispielsweise
Kazimierz neben Krakau. Kazimierz
erhielt 1568 das Privileg "de non
tolerandis christianis", 1633 wurde
dieses Recht an die Gemeinde in
Poszen und 1645 an fast alle
litauischen Gemeinden vergeben.
Aufgrund ihrer großen Anzahl konnten
die Juden in Polen unter sich
bleiben und eigenständige, völlig
autonom lebende Gemeinden, die
Schtetlech bilden. Tamar Somogyi
stellt fest, daß sich hier "(...)
zum ersten Mal seit der spanischen
Blüte eine eigene, selbständige
jüdische Kultur in Werken und
Werten" entfaltete. Polen galt
als Paradies der Juden, im 16.
Jahrhundert gab es dazu sogar ein
Sprichwort : "Die Republik Polen
ist des Bauern Hölle, des Städters
Fegefeuer, des Edelmanns Himmel und
des Juden Paradies."
Voraussetzung für diese kulturelle
Hochblüte war unter anderem auch die
Selbstverwaltung, die den Juden in
den verschiedenen fürstlichen
Privilegien zugesprochen wurde.
"Es gab eine Zeit, da die autonome
Verfassung der jüdischen Gemeinden
in Polen es jedem einzelnen Juden
möglich machte," so Simon
Dubnow, "sich als Bürger eines
eigenen, mitten in das christliche
Königreich eingefügten "Staates" zu
betrachten und aus diesem Bewußtsein
Kraft zur Abwehr des von der Umwelt
ausgeübten Druckes zu schöpfen."
Die Kahal, ein Rat, der sich aus den
Rabbinern und der von der Gemeinde
gewählten Ältesten zusammensetzte,
sorgte für Ordnung in der Gemeinde
und lieferte die Steuerabgaben an
den Staat. Weiterhin war die Kahal
für die verschiedenen öffentlichen
Organisationen, sowie für das
Erziehungswesen zuständig. Auf diese
Weise konnte die Gemeinde völlig
unabhängig vom Staat existieren, die
Traditionen gewahrt und die Kinder
nach jüdischen Grundsätzen erzogen
werden. Diese Organe der einzelnen
Gemeinden unterstanden der zentralen
Institution des `Vielländer-Sejm´
oder auch Wa´ad, benannt nach den
vier Bezirken Groß- und Kleinpolen,
Litauen und Weißrußland. Der Wa´ad
diente der polnischen Regierung in
der Judenfrage als Ansprechpartner.
Ein Wendepunkt kam
mit dem Jahr 1648. Der
Kosakenaufstand, dem sich die
ukrainische Bauern anschlossen,
führte zu Metzeleien unter
polnischen Adeligen und Juden als
deren angeblichen Handlangern, denen
Hunderttausende zum Opfer fielen.
Zum ersten Mal war die Existenz der
Juden auch in Polen bedroht. Der
Strom der Migration begann sich zu
drehen, vom Osten zurück nach
Westeuropa.
Diese Zeit ist
auch der Beginn des Verfalls in der
polnischen Geschichte, vor allem
durch den ökonomischen Ruin infolge
des polnisch-schwedischen Krieges.
Die Juden stellten fest, daß sie von
der territorialen Integrität Polens
abhängig waren. Mit dem Zerfall
Polens, verfiel auch die jüdische
Selbstverwaltung, die
Kahalorganisation wurde mehr und
mehr zu einem Instrument
innerjüdischer Ausbeutung.
Es war die Zeit von großen Miseren
und Armut, eine Blütezeit radikaler
Bewegungen.
Mit der
Verbreitung der Konterreformation
durch die Kirche wurden Juden
zunehmend diskriminiert, Polen
verlor seine Anziehungskraft auf den
Westen, denn auch die jüdische
Kultur und Wissenschaft verfielen.
Durch die Schwäche der polnischen
Zentralgewalt breitete sich
politische Anarchie aus. Die Arbeit
der jüdischen Institutionen wurde
erschwert, die Steuern mußten
zunehmend für Bestechung der
Behörden gebraucht werden, was den
Unmut gegen die jüdische
Gemeindeverwaltung steigerte. 1764
wurde der Vierländersejm abgeschafft
und eine Kopfsteuer von 2 Sloty
eingeführt.
Durch die
Polnischen Teilungen wurden die
Juden drei verschiedenen Regierungen
unterworfen. Die wichtigsten Teile
Polens, Litauen, Zentral- und
Ostpolen, erhielt Rußland. Das
Siedlungsrecht der Juden innerhalb
dieser Gebiete und Rußlands wurde
zunächst auf verschiedene Provinzen
und nach den übrigen polnischen
Teilungen auf das sogenannte
Ansiedlungsrayon begrenzt. In diesem
Gebiet lebten 4,9 der 5,2 Millionen
russisch-polnischen Juden wie in
einem riesigen Ghetto eingepfercht.
Zudem gab es auch innerhalb des
Streifens Städte mit
Niederlassungsverbot für Juden, zum
Beispiel Kiew und Sevastopol,
Provinzen mit Niederlassungsverbot
in Dörfern und einen 50-Werst
Streifen entlang der Westgrenze mit
Neuansiedlungsverbot für Juden.
Die folgenden
Jahrzehnte waren durch die Versuche
der osteuropäischen Regierungen
gekennzeichnet,
"durch Gesetze und drakonische
Verwaltungsmaßnahmen, die jüdische
Bevölkerung zur Assimilation zu
zwingen."
Zur vorherigen Teil
Zum naechsten Teil
1996© Andrea Ehrlich
|