|
Israelis auf der Flucht:
Zimmer im Süden, verzweifelt gesucht
Ob bei Fremden, im Kibbuz oder in
Zelten - die Israelis, die der Krieg zu Vertriebenen im eigenen Land gemacht
hat, werden solidarisch aufgenommen.
Von Thorsten Schmitz, Süddeutsche Zeitung v. 10.08.2006
Lis Asulin ist zehn Jahre alt, trägt eine Brille und hat
langes schwarzes Haar. Wenn sie redet, verdreht sie nervös ihre Augen, als
halte sie nach etwas Ausschau. Alle paar Minuten wird sie von einem
Schluckauf geschüttelt.
Sie atmet unregelmäßig. Wenn der Schluckauf kommt, nimmt ihre
Mutter Sima sie in den Arm. Der Schluckauf und das schwere Atmen sind
körperliche Reaktionen von Lis auf den Raketenbeschuss ihrer Heimatstadt
Haifa. An diesem Montagabend sitzt Lis mit ihrem Vater, der Mutter und der
großen Schwester 150 Kilometer südlich von Haifa auf einer Matratze in einem
Dorf namens Hulda, von dem sie bis vor kurzem noch nie gehört hatte.
Die Familie Asulin hat die Wohnung in Haifa vor drei Wochen
überstürzt mit Dutzenden Plastiktüten verlassen, in denen sie das
Notwendigste verstaut haben. Eine Bekannte hatte ihnen die Nummer der
Familie Scherf im Kibbuz Hulda gegeben. Erst hatte sich Sima Asulin geziert,
doch dann wählte sie die Nummer der Scherfs.
"Hallo, guten Morgen, ich habe gehört, sie hätten ein Zimmer
frei. Wir sind aus Haifa und haben Angst vor den Raketen." - "Kommen Sie!
Wir haben ein Zimmer im Erdgeschoss, das können Sie haben. Es hat eine
Toilette und eine Dusche."
Zwei Stunden später standen sich die beiden fremden Familien
zum ersten Mal gegenüber, die Flüchtlinge aus dem Norden und das ältere
Ehepaar im Kibbuz Hulda, in dem der berühmte Schriftsteller Amos Oz die
meiste Zeit seiner Jugend verbracht hat.
Clowns für die Kinder
Seit Beginn der Libanon-Offensive der israelischen Armee vor
einem Monat hat eine Völkerwanderung eingesetzt. Mehrere hunderttausend
Menschen aus den nördlichen Dörfern und Städten haben die Flucht vor dem
täglichen Raketenbeschuss der Hisbollah ergriffen und sind in Hotels,
Privatzimmern oder bei wildfremden Menschen in den südlichen Landesteilen
untergekommen.
Die Menschen finden sich über Annoncen in den Zeitungen, über
Hotlines oder über das Fernsehen, das jeden Tag Wohnungsofferten
veröffentlicht. Anstatt in die Sommerferien zu fahren, haben die
Flüchtlingsfamilien Schutz gefunden bei wildfremden Menschen, deren Vorteil
es ist, dass ihre Wohnungen und Häuser - noch - außerhalb der Reichweite der
Hisbollah-Raketen liegen.
Im Kibbuz Hulda haben rund 140 Familien aus Nordisrael eine
Ersatzheimat gefunden. Die Menschen in dem Gemeinschaftsdorf haben ihre
Türen geöffnet, und sind selbst ein wenig überrascht darüber, wie viel Leben
plötzlich herrscht.
Der Swimmingpool, an dem abends eine Eventfirma Hochzeiten
veranstaltet, ist nun tagsüber geöffnet und brechend voll. Der Esssaal des
Kibbuzes, vor acht Jahren mangels Nachfrage endgültig geschlossen, ist nun
wieder am Mittag und am Abend für die Massenspeisung der Flüchtlinge
geöffnet.
Aus den umliegenden Dörfern kommen Clowns und
Performancekünstler, um die Flüchtlinge und ihre Kinder bei Laune zu halten.
Plötzliche Idylle
Lis genießt die plötzliche Idylle, sie kann auch wieder
lachen, erzählt ihre Mutter. Im Bombenhagel in Haifa habe Lis ständig
geweint, Albträume gehabt und sich Sorgen gemacht, von einer Rakete
getroffen zu werden. "Was für ein Leben ist das, wenn deine Kinder nicht
wissen, ob sie im nächsten Moment von einer Rakete getötet werden?", sagt
Sima Asulin. In den ersten Tagen der Angriffe habe sie sich keinen
Zentimeter aus der Wohnung bewegt.
Die Asulins haben keinen Schutzraum in ihrer Wohnung, weshalb
sie jedes Mal beim Ertönen der Sirenen ins Treppenhaus gerannt sind, um dort
vor den Raketen Sicherheit zu suchen. "Ich bin manchmal 16 Mal am Tag von
der Wohnung ins Treppenhaus gerannt. Einkaufen habe ich mich schon gar nicht
getraut", sagt Sima Asulin und zeigt auf ihren Mann, der ihr auf einem Sofa
gegenüber sitzt.
"Ich bin abgehauen, das gebe ich ganz ehrlich zu", sagt Sima
Asulin. "Meine Angst hat sich auf meine Kinder übertragen."
Von der Telefongesellschaft Bezeq, bei der Sima Asulin
arbeitet, hat sie für die Dauer des Krieges frei bekommen.
Ihr Mann Pinchas, der in einem Möbelladen in Haifa arbeitet,
ist in den ersten Tagen noch in der Stadtwohnung geblieben. Er wollte nicht
vor den Raketen fliehen. Die drei adoptierten Söhne sind bei der Armee, wo
sie sich gerade aufhalten, weiß er nicht, aber er macht sich Sorgen. Ständig
schaut er auf sein Handy.
Plötzlich klingelt es, und er verlässt das Zimmer der
Scherfs. Er setzt sich auf eine alte rostige Hollywoodschaukel im Garten und
lauscht in das Telefon. Als er auflegt, rauft er sich die Haare und schaut
in den Himmel. Es war einer seiner Söhne.
Er wollte ihm sagen, dass sie jetzt mit seiner Einheit in den
Libanon marschieren. Pinchas Asulin war selbst im ersten Libanon-Krieg als
Soldat im Einsatz. Reden möchte er über seine Erlebnisse nicht. "Ich habe
Dinge erlebt, an die ich mich nicht mehr erinnern möchte."
Seine Frau Sima sagt: "Noch nicht mal mir hat er von dem
Krieg erzählt." Die beiden schweigen. Ihre Wohnung in Haifa haben sie seit
drei Wochen nicht mehr betreten. "Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch
steht", sagt Pinchas Asulin. Aber das sei ihm egal: "Hauptsache, wir leben."
Ein Millionär sorgt für Kühle
Seit Beginn des Krieges lebt das ganze Land in einem
Ausnahmezustand. Die Flüchtlinge aus dem Norden verändern das Straßenbild in
den Städten im Süden. Am auffälligsten ist das in Tel Aviv zu beobachten. Wo
im August eigentlich Hochsaison herrscht und Touristen aus aller Welt
erwartet werden, spazieren nun Großfamilien mit Stadtplänen in der Hand
durch die unübersichtliche Metropole am Mittelmeerstrand.
Entlang der Küste fliegen jeden Tag Dutzende
Kampfhubschrauber auf ihrem Weg in den Norden. Bis auf französische Juden,
die Tel Aviv im August in ein zweites Paris verwandeln, gibt es kaum andere
Touristen aus dem Ausland. Viele haben ihre Urlaube storniert.
Dafür verstopfen jetzt die Autos der Flüchtlinge die Straßen.
Parkplätze in den Wohngebieten, wo Flüchtlinge bei Privatfamilien
untergekommen sind, sind knapp geworden.
Jeder Flüchtling hat einen Zettel im Auto, um Strafzettel zu
vermeiden: "Lieber Polizist, wir sind aus dem Norden nach Tel Aviv
geflüchtet." Die Stadtverwaltung zeigt sich kulant und verteilt keine
Tickets.
Eine Solidaritätswelle hat das Land erfasst. Die Banken, die
ihre Filialen im Norden geschlossen haben, senden fahrbare Zweigstellen in
das Raketengebiet, damit die Menschen, die keine Unterkunft im Süden des
Landes gefunden haben, wenigstens an Geld kommen.
Kreditkartenfirmen erlauben den Nordisraelis, ihren
Kreditrahmen zinslos zu überziehen, Supermärkte bieten Warenkörbe für
niedrige Preise an. Ein kanadischer jüdischer Millionär hat Hunderte mobile
Klimaanlagen für die Menschen in den Bunkern im Norden gespendet.
In der Touristenhochburg Eilat am Roten Meer befinden sich
zweieinhalb mal so viele Flüchtlinge aus dem Norden wie Bewohner - 120.000
Menschen. Viele wohnen für niedrige Raten zu siebt oder acht in den Zimmern
oder campen am Strand oder in öffentlichen Schulen.
An den Stränden sind Wassertanks und mobile Toiletten
errichtet worden. An vielen Autos wehen israelische Flaggen, mit denen man
eigentlich im Frühjahr die Gründung des Staates Israel feiert. Jetzt sollen
sie das Nationalgefühl stärken.
Die Bank Leumi hat in den Städten einen Satz plakatiert, den
auch die Regierung in Jerusalem jeden Tag wiederholt: "Wir werden siegen".
Das Tel Aviver Stadtmagazin Time out gewinnt dem Flüchtlingsstrom seine
guten Seiten ab und berichtet in seiner jüngsten Ausgabe darüber, dass die
Nordisraelis zu einem 30-prozentigen Umsatzplus in der Metropole beigetragen
hätten. Ob sie ihren unfreiwilligen Aufenthalt genießen, das steht auf einem
anderen Blatt.
Als am vergangenen Freitag abends um neun Uhr die Sirenen in
Binjamina erklangen, einer Kleinstadt auf halber Strecke zwischen Tel Aviv
und Haifa gelegen, suchte Lara Berg im Badezimmer ihrer Drei-Zimmer-Wohnung
Schutz. Ihr Mann Tal war gerade auf den Feldern mit den zwei Hunden. Er kam
nach wenigen Minuten angerannt.
"Wir hatten plötzlich große Angst", erzählt Lara Berg am
Strand von Tel Aviv und streichelt ihre beiden Hunde. Innerhalb von Minuten
fällte das frisch vermählte junge Paar die Entscheidung, alles stehen und
liegen zu lassen und nach Tel Aviv zu fahren, wo sie jetzt schon seit einer
Woche bei Freunden wohnen.
Der Schwebezustand, sagt Lara Berg, die als freie
Schlussredakteurin arbeitet, sei das Unerträgliche: "Wir wissen nicht, wann
der Krieg aufhört und wie lange wir hier bleiben müssen. Ihre Nervosität
drückt sich darin aus, dass sie auf ihren Lippen kaut. Ihr Ehemann Tal
arbeitet in einer High-Tech-Firma, die seit Beginn des Krieges ihren
Standort in Haifa vorübergehend geschlossen und nach Petach Tikva nahe Tel
Aviv verlegt hat.
Er sehnt sich nach Hause zurück, "aber wir werden erst
zurückgehen, wenn der Krieg aufhört". Die beiden laufen am Strand von Tel
Aviv, eine frische Brise vertreibt die drückende Hitze vom Tag, um sie herum
amüsieren sich unerschrockene französische Touristen, aus einem Strandcafé
ertönt Technomusik.
"Man könnte meinen, wir sind im Urlaub", sagt Lara Berg,
"aber es ist Krieg, und wir sind aus unseren Wohnungen vertrieben worden."
Wie zur Bestätigung fliegen zwei Hubschrauber über ihren Köpfen hinweg.
Auch am Strand von Nitzanim, zwischen den Hafenstädten
Aschkelon und Aschdod gelegen, sieht es auf den ersten Blick so aus, als
hätte Club Med hier eine Zweigstelle eröffnet. Die Zeltstadt ist eine Spende
des zwielichtigen russischen Millionärs Arkadi Gaydamek, er hat sie auf
eigene Kosten innerhalb von nur 48 Stunden errichten lassen.
Angeblich kostet ihn die Nächstenliebe eine halbe Million
Dollar am Tag. Die Menschen hier lieben ihn dafür, dass er ihnen ein Dach
überm Kopf zur Verfügung stellt, in Frankreich liegt ein Haftbefehl gegen
ihn vor wegen Steuerhinterziehung und Waffengeschäften mit Angola. Die
Menschen in Gaydameks gigantischem Zeltlager tragen blaue, grüne oder gelbe
Armbänder, die über die Reihenfolge bei der Essensvergabe Auskunft geben.
Weiße große Zelte sind errichtet worden, die sonst für Partys
oder Hochzeiten verwendet werden. Es gibt Yoga-Kurse für Erwachsene und
Malkurse für Kinder. Man kann Tischtennis spielen und surfen lernen,
Billardtische gibt es und eine Karaoke-Anlage. In einem der Zelte wird alle
zwei Stunden ein Kinofilm gezeigt, überall stehen Fernseher, auf denen
aktuelle Nachrichten über den Krieg im Norden laufen.
Nur Zimmer gibt es keine. Die rund 6000 Menschen, die vom
Norden nach Nitzanim geflüchtet sind, schlafen auf Matratzen. 300 in jedem
Zelt, Privatsphäre gibt es keine.
Aber: Fünf Mahlzeiten am Tag und sogar psychologische
Betreuung. Shay Gal, einer der unentgeltlich arbeitenden Psychologen, sagt:
"Alles sieht hier nach Urlaub aus, aber die Leute sind im mentalen Stress.
Sie wollen hier nicht sein, sie müssen es aber, weil sie um ihr Leben
fürchten. Manche haben Raketenangriffe direkt erlebt und leiden unter
Traumata. Und viele können sich an die Enge hier nicht gewöhnen."
Stress und Streit im Bunker
Ruthi Schelev etwa. Die 37-jährige Hausfrau aus der
Grenzstadt Naharija sitzt in einem Campingstuhl neben ihrer Matratze und
lackiert sich die Nägel. Erst will sie gar nicht reden, dann sprudelt es nur
so aus ihr raus.
"Natürlich sind wir froh, dass wir hier unterkommen konnten,
aber es ist ein Albtraum. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich
einmal in meinem Leben ein Flüchtling sein würde."
Flüchtlinge, das seien doch immer "die anderen gewesen, die
aus dem Fernsehen". Mit ihrem Mann, der gerade duschen gegangen ist, und den
vier Kindern im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, die sich am Strand tummeln,
sind die Schelevs vor einer Woche aus Naharija geflüchtet.
"Wir sind wahnsinnig geworden im Bunker. Die Luft steht, es
gibt nichts zu tun, man streitet sich, man wird verrückt." In der Zeltstadt
"kann ich wenigstens atmen".
Sie hoffe, dass der Krieg bald aufhöre, aber glauben tut sie
nicht daran: "Jeden Tag fallen immer noch 200 Raketen auf unsere Städte, das
wird noch Monate dauern."
Kritik am Krieg übrigens hört man weder von Familie Asulin,
noch von Schelev noch von dem jungen Paar in Tel Aviv. Alle unterstützen die
Militäroffensive. Auch Lis, die Zehnjährige aus Haifa. "Wir kämpfen gegen
Nasrallah, weil er uns umbringen will", sagt sie und rückt ihre Brille
zurecht. "Wir müssen stark sein."
Dann muss sie eine Pause einlegen, weil sie wieder einen
Anfall von Schluckauf hat. Als der sich gelegt hat, erzählt sie vom Lärm
einschlagender Raketen und wie die Wände in der Wohnung gewackelt hätten:
"Ich habe die ganze Zeit geweint." Wenn man sie fragt, warum Israel mit
Raketen beschossen werde, sagt Lis: "Weil wir Juden sind, hasst uns
Nasrallah."
Und dann sagt sie noch einen irritierend vernünftigen Satz
für eine Zehnjährige: "Es ist okay, wenn jemand uns hasst. Aber warum muss
man uns denn umbringen?"
Mit freundlicher Genehmigung der
Süddeutsche Zeitung und der
DIZ München
GmbH
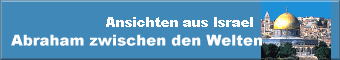
hagalil.com 11-08-2006 |