|
Jüdische DPs in Mittel und Oberfranken
Die Jüdische Nachkriegsgemeinde:
Ausgerechnet in Pottenstein
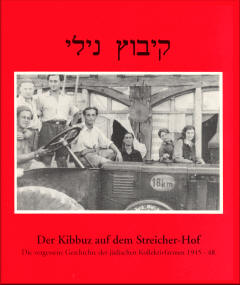 100
Displaced Persons (DPs) gründeten den zionistischen Verein "Achida"
und das Fussballteam "Makkabi" 100
Displaced Persons (DPs) gründeten den zionistischen Verein "Achida"
und das Fussballteam "Makkabi"
von Jim G. Tobias
Durch das Aussenlager des Konzentrationslagers
Flossenbürg und mehr noch durch die Schwierigkeiten mancher
Pottensteiner, diese Zeit aufzuarbeiten und zu bewältigen, ist das
Felsenstädtchen in den letzten Jahren immer wieder negativ in die
Schlagzeilen geraten. Nun gibt es ein weiters Kapitel bisher
unentdeckter Heimatgeschichte.
Es klingt schier unglaublich: Ausgerechnet in Pottenstein wohnten
und arbeiteten nach 1945 für etwa zwei Jahre cirka 100 jüdische DPs
(Displaced Persons - zu deutsch: verschleppte, entwurzelte
Menschen), die das Martyrium der nationalsozialistischen Lager
überlebt hatten. Für kurze Zeit kam es in dem heutigen fränkischen
Urlaubsparadies zu einer Wiedergeburt des jüdischen Lebens.
"Warum haben sich Juden in diesem entlegenen Dorf
niedergelassen?", wird der ehemalige KZ-Häftling und spätere
Pegnitzer Geschäftsmann David Minkowski in dem Artikel "Fun jidiszn
lebn in Pottenstein" in der ZeitungUndzer Weg vom 22. Juni 1947
zitiert. Das in Bamberg verlegte jiddisch-sprachige Wochenblatt
wurde vom "Regionalkomitee der befreiten Juden in der US-Zone"
herausgegeben.
David Minkowksi gehörte zu den ersten sieben Juden
die sich in der fränkischen Kleinstadt ansiedelten. Die Männer waren
Ex-Häftlinge des KZ-Aussenlagers Flossenbürg in Pottenstein. Die
örtliche US-Militärverwaltung unterstütze die Ansiedlung von
jüdischen DPs in der oberfränkischen Region. Beispiele sind die
zahlreichen kollektiven Trainigsfarmen (Kibbuzim), die zwischen
Pegnitz und Bayreuth eingerichtet wurden. Neben diesen jüdischen
Bauernschulen liessen sich einige Überlebende des Holocaust auch in
zum Beispiel in Creussen oder Pegnitz nieder.

Bereits im Juni 1945 zählte man 25 Juden in
Pottenstein. Einer Statistik des Central Committee of liberated Jews
in the US-Zone, Region Bamberg vom 25. August 1946 zufolge gehörten
zur Jewish Community Pottenstein 61 Männer, 24 Frauen und zwei
Kinder. Bis Anfang 1948 lässt sich anhand von Unterlagen, aus dem
amerikanischen YIVO-Institute for Jewish Research , New York eine
jüdische Gemeinde nachweisen. Die Menschen waren wahrscheinlich im
ehemaligen KZ-Lager in der sogenannten Magerscheune und in einigen
beschlagnahmten Wohnungen untergebracht. Das Jüdische Komitee und
die Schule befand sich in einem von der Stadt gepachteten Gebäude.
Vor dem Krieg lebten keine Juden in der oberfränkischen Kleinstadt.
Heute deutet nichts mehr auf das jüdische
Pottenstein hin. Die Spuren sind verwischt und viele Zeitzeugen sind
längst tot. Dank der im YIVO-Institute archivierten Dokumente ist es
jedoch möglich, die Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen.
Am Sonntag, dem 11. August 1946 trafen sich die
Pottensteiner Juden im Dorfgasthaus und gründeten den zionistischen
Verein "Achida". In Referaten wurde über das Ringen des jüdischen
Volkes um eine nationale Heimstatt in Palästina informiert. David
Rosenberg, ein Vorstandsmitglied der Pottensteiner Gemeinde, rief
die Zuhörer auf "im Kampf um den Aufbau Israels" nicht nachzulassen.
Das begeisterte Publikum honorierte die Redebeiträge mit dem
Absingen der Hatikwa und anderen hebräischen Liedern. Am selben Tag
kam es auch zur Gründung des jüdischen Sportclubs. In einer
Kurznotiz aus Undzer Wort vom 24. August 1946 heisst es: "Der neu
gegründete Sportclub Makkabi Pottenstein bittet alle jüdischen
Sportvereine um Kontaktaufnahme. Bitte schreibt an: Jüdisches
Komitee Pottenstein."
Der Fussballclub Makkabi Pottenstein spielte
fortan in der "A-Klasse des Rayon Franken". Die Jidisze Sport
Cajtung (JSC) informierte regelmässig über die Aktivitäten der
zahlreichen Vereine. In der JSC-Ausgabe vom November 1947 wird
berichtet, dass Makkabi die Saison mit einem Mittelplatz beendete.
Pottenstein belegte den 6. Rang von insgesamt 12 Teams. Spannend war
es jedoch auch noch nach Abschluss der Pflichtspiele an der
Tabellenspitze. Die Mannschaften von Hapoel Bayreuth und Makkabi
Münchberg teilten sich punktgleich die Führung. Ein Match, das über
Meisterschaft und Aufstieg in die "Liga" entscheiden sollte, wurde
angeordnet.
"Am Schabbes den 15. November fand auf neutralem
Boden (leider informiert uns der Korrespondent der JSC nicht über
den Ort der Begegnung) das Finalspiel um die Meisterschaft in der
Bamberger Region statt". Trotz schlechtem Wetter war das Spiel gut
besucht. Viele Fans aus Münchberg und den umliegenden Kibbuzim
unterstützten ihre Mannschaft lautstark. Doch der Überlegenheit der
Bayreuther hat das Team aus Münchberg nichts entgegenzusetzen.
Bereits eine viertel Stunde vor Spielende verliessen die gefrusteten
Makkabi-Spieler das Feld. "So blieb es beim verdienten 4 : 2 Sieg
von Hapoel Bayreuth, das den technisch besseren Fussball spielte",
resümierte die Jidisze Sport Cajtung.
Nach einer zeitgenössischen Quelle wird die Zahl
der jüdischen Sportclubs in den westlichen Besatzungszonen mit 169
Vereinen angeben. Neben Fussball gab es noch organisiertes Boxen,
Schach und Tischtennis. Ob auch in Pottenstein alle diese Sportarten
ausgeübt wurden, lässt sich nur erahnen. Sicher ist, dass sich die
Pottensteiner Juden jeden Abend in ihrem Clubhaus versammelten.
Vielleicht wurde dort nach erbitterten Diskussionen über das
zukünftige Leben im noch zu schaffenden eigenen Staat zur
Entspannung ein Schachturnier gegen den SC Bar Kochbar Regensburg
gespielt?
Über die zahlreichen jüdischen
Nachkriegs-Landgemeinden und Camps liegen kaum Erkenntnisse vor.
Eins ist jedoch sicher: Die Überlebenden des Holocaust betrachteten
ihre vorübergehende Heimat im Lande der Täter nur als
Durchgangsstation. In den "Wartesälen" hatten die an Leib und Seele
gequälten Menschen die Möglichkeit wieder zu Kräften zu kommen und
sich auf ihr neues Leben in Israel oder Amerika vorzubereiten.
 Buchhinweis: Buchhinweis:
In seinem Buch "Vorübergehende Heimat
im Land der Täter – Jüdische DP-Camps in Franken 1945-1949"
dokumentiert der Autor ausführlich die damalige Lebenssituation und
-wirklichkeit der Juden in den fränkischen "Wartesälen". Der Band
kostet 22,80 Euro und kann in jeder Buchhandlung oder beim
Verlag
bestellt werden (ISBN 3-9806636-3-9).
Nakam":
Jüdische Rache an NS-Tätern
Rache als Mittel, das den
Schmerz zwar nicht aufheben, wohl aber dämpfen und lindern kann.
Viele dachten, daß sie nur deshalb die Konzentrationslager überlebt
hatten, um Rache für die ermordeten Verwandten zu nehmen. Das Buch
von Jim G. Tobias und Peter Zinke berichtet von Juden und Jüdinnen,
die diese Gedanken in die Tat umgesetzt haben...
Trainingskibbuz Zettlitz:
Jüdischer Neubeginn
in Oberfranken
Im Oktober 1945 wurde in Zettlitz der
erste Nachkriegskibbuz in Franken gegründet – Jüdische
Dokumentarfilmer bannten das Kibbuzleben auf Zelluloid...
Der Strick mit dem Knoten:
Das
Palmsonntagspogrom
Der 25. März 1934 ging als
"Blutpalmsonntag" in die Geschichte Gunzenhausens ein; die Vorgänge
an diesem Abend blieben als "Palmsonntagspogrom" in schauriger
Erinnerung... |