|
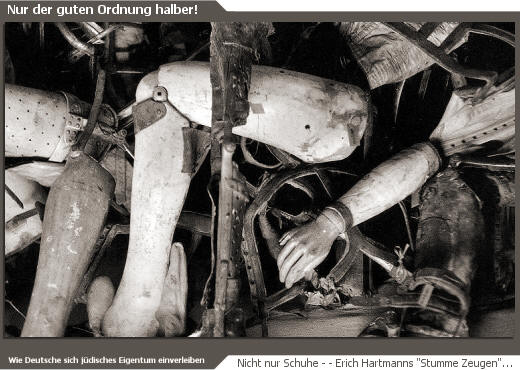
Gam razachta vegam rachaschata:
Nur der guten Ordnung halber!
Auch in Schöneiche bei Berlin wurde das Verschwinden jüdischer Nachbarn
verwaltet - "ordnungsgemäß".
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten an nahezu jedem Ort im Deutschen Reich
Juden und Nichtjuden, Christen und Nichtchristen gemeinsam. Auch in der
damaligen Gemeinde Klein-Schönebeck mit den Ortsteilen Grätzwalde, Fichtenau und
Hohenberge sowie im Gutsdorf Schöneiche und in der Villenkolonie Schöneiche
verhielt es sich so.
Unter den jüdischen Schöneichern waren Familien, die religiös lebten ebenso wie
Familien, die nur an den hohen Feiertagen die Synagoge aufsuchten, Familien, die
zum Christentum konvertiert waren und ihre Kinder hatten taufen und konfirmieren
bzw. firmen lassen ebenso wie Atheisten oder solche, die aus anderen Gründen aus
dem Judentum ausgetreten waren; es gab Frauen mit einem nichtjüdischen Ehemann
und Männer mit einer nichtjüdischen Ehefrau; es waren Familien, die in
Schöneiche ein eigenes Haus bewohnten oder aber zur Miete wohnten, und damals
wie heute gab es Wochenendschöneicher, die ihre Sommerhäuschen während eben
dieser Jahreszeit bewohnten.
Sie lebten in der Lindenstraße, in der Berliner Straße, in der heutigen
Geschwister-Scholl-Straße und Am Pelsland, in der Parkstraße, am Kieferndamm und
vielen anderen Straßen. Sie waren Schöneicher wie ihre Nachbarn und
unterschieden sich in nichts von diesen. Unter ihnen waren wohlhabende Familien
ebenso wie Familien oder Alleinstehende, denen es wirtschaftlich nicht gut ging.
Auch in dieser Hinsicht unterschieden sie sich nicht von den nichtjüdischen
Schöneichern.
Sie übten Berufe aus wie eben Schöneicherinnen und Schöneicher es tun, damals
wie heute: Die Bandbreite reichte von der Kohlenhändlerin und dem kaufmännischen
Angestellten bis zum Stadtschularzt und zur Strumpfwarenverkäuferin, vom
Bildhauer über die Schneiderin bis zum Schlachtermeister. Der durchschnittliche
Schöneicher der damaligen Zeit war der "Angestellte", auch in diesem Punkt
unterschied sich die jüdische nicht von der nichtjüdischen Bevölkerung
Schöneiches.
Vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten lebten in Schöneiche bei Berlin
mehr als 150 jüdische Menschen.
Die Ausstellung "Ich besaß einen Garten in Schöneiche bei Berlin" - Zeugnisse
des verwalteten Verschwindens jüdischer Nachbarn umfasst etwa 70 Dokumente aus
Archiven (Brandenburgisches Hauptstaatsarchiv Potsdam, Landesarchiv Berlin,
Bundesarchiv Berlin) sowie historische Fotos. Sie dokumentieren beispielhaft das
Verschwinden - Vertreibung und Vernichtung - unserer jüdischen Nachbarn.
Von Mai bis Ende Juli 2001 war die Ausstellung erstmalig in den Fluren des
Rathauses von Schöneiche bei Berlin zu sehen. Mit der Wahl des Ausstellungsortes
wollte die Autorin daran erinnern, dass auch in Amtsstuben eben dieses Rathauses
an Vertreibung und Ermordung unserer jüdischen Nachbarn mitgewirkt wurde. Die
Ausstellung traf in der Bevölkerung auf so großes Interesse, dass sie an
weiteren Orten der Region gezeigt wird, vom 8. November bis 31. Dezember im
Landratsamt Beeskow.
Anregungen und weitere Hinweise zur Geschichte der jüdischen Schöneicher sind
sehr willkommen, auch wenn inzwischen, infolge der Ausstellung, ein Buch
erschienen ist.
"Ich besaß einen Garten
in Schöneiche bei Berlin"
von Jani Pietsch
EUR 24,90, kostenlose Lieferung, gewöhnlich versandfertig bei Amazon in 2 Tagen.
Broschiert - 300 Seiten - Campus Verlag, Erscheinungsdatum: März 2006
[Bestellen?]
Nach dem größten
Massenraubmord der Geschichte:
Ausgeplündert und auf
Almosen angewiesen
Warum sind denn praktisch alle
jüdischen Gemeinden in Deutschland von heute mittellos und "reich" nur noch an
Schulden?... |