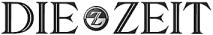
Feuilleton 44/2001
Anmaßende Einfühlung in die Opfer
Ein kritischer Blick auf das Jüdische Museum in
Berlin: Es atmet den Geist der Versöhnung. Aber sonst?
von Amos Elon
Henry Kissinger wollte ursprünglich nicht zur feierlichen Eröffnung des
Jüdischen Museums nach Berlin kommen. In Paris war ihm kürzlich
Unerfreuliches in der Öffentlichkeit widerfahren, nachdem man ihm in
einer Publikation Völkermord in Vietnam und Kambodscha vorgeworfen
hatte. Er ließ sich dann aber doch erweichen, als das deutsche
Außenministerium ihm versicherte, es sei "schlicht undenkbar", dass
einem Kissinger anlässlich der Einweihung eines jüdischen Museums in
Berlin Ähnliches passieren könnte. Nach der Besichtigung der Ausstellung
soll Kissinger gesagt haben: "Das ganze Zeug aus dem Mittelalter kannte
ich gar nicht."
Der Zweck des neuen Museums ragt jedoch weit über das Mittelalter
hinaus. Es hat sich in der Tat eine gewaltige Aufgabe gestellt und will
nicht nur Kultur und Lebensstil deutscher Juden bis zur Neuzeit, sondern
auch deren Vielfalt und Leistungen während der Blütezeit der so
genannten deutsch-jüdischen "Symbiose" im 19. und 20. Jahrhundert
bildlich dokumentieren. Bei dieser Symbiose handelt es sich freilich
eher um eine missglückte (weil einseitige) Liebesgeschichte. Vor Hitler
haben andere Europäer die Deutschen oft bewundert, beneidet oder
gehasst; aber nur Juden, auch außerhalb Deutschlands, haben die
Deutschen und ihre Kultur buchstäblich geliebt. Darum wohl sind die
Spannungen zwischen Deutschen und Juden manchmal auf eine angebliche
"Familienähnlichkeit" zurückgeführt worden. Heine nannte sie
großsprecherisch die zwei "ethischen Völker" Europas; gemeinsam würden
sie ein neues messianisches Zeitalter einleiten. Nach der Katastrophe
stritt man um die Frage, ob es je einen "Dialog" oder gar eine
"Symbiose" zwischen Deutschen und Juden gegeben habe. Der Streit war
mühsam. Denn tatsächlichen Dialog kann es bloß zwischen Individuen
geben; Völker brüllen sich nur an. Der Begriff "Symbiose" - der Botanik
(!) entlehnt - ist ebenso zweifelhaft. In einer symbiosis im
biologischen Sinne kann eine Lebensart einfach nicht ohne die andere
existieren.
Als das Museum im vergangenen Monat eröffnet wurde, erinnerten sich nur
wenige daran, dass es nicht das erste jüdische Museum in Berlin war. Das
letzte hatte man im Januar 1933 in aller Stille eröffnet, nur eine Woche
vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler (ein "echtes Museum mit
Bildern und Kupferstichen und Kunsthandwerk ... alles gut arrangiert",
schrieb das Berliner Tagblatt vom 24. Januar 1933). Besucher
kamen nur wenige. Wir werden nie erfahren, ob die Eröffnung zu diesem
Zeitpunkt ein Akt der Aufsässigkeit oder Naivität war. Karl Schwartz,
der Direktor, schrieb später, man hätte vom ersten Tag an gespürt, dass
"der Hauch des Todes durch die Hallen wehte".
Architektur und Ausstellung in offenem Konflikt
Die öffentliche Einweihung des neuen Museums in der Stadt, die den
Holocaust hervorbrachte und verwaltete, war ein Staatsakt mit
bemerkenswerten Untertönen. Die Bundesrepublik ist vielleicht das
einzige europäische Land, das offiziell um die Opfer seiner Aggression
trauert und ihrer gedenkt. (England ist das andere Extrem: Überall in
London stehen Denkmäler, die blutige Schlachten, Generäle, Regimenter
und uniformierte Kriegsverbrecher aus längst vergessenen Kolonialkriegen
feiern, und gleich neben dem Hyde Park befindet sich sogar ein
wahrscheinlich einzigartiges Denkmal, zu Ehren eines Maschinengewehrs
vom Typ Maxim - oben ein nackter Lustknabe, unten das Bibelzitat: "Saul
hat tausend erschlagen, aber David zehntausend"; was eine Verbindung
zwischen Krieg, Sex und Religion nahe legt.)
Das öffentliche Interesse an dem neuen Berliner Museum ließ sich nur
mit der vor kurzem erfolgten Einweihung des neuen, für den Bundestag
umgebauten und renovierten Reichstagsgebäudes vergleichen. Noch während
das Museum leer stand, zahlten fast 400 000 Besucher acht Mark Eintritt
für eine Begehung der schiefen Ebenen, verwinkelten Korridore und
geneigten Böden. Die Direktion könnte noch bedauern, dass sie das leere
Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte, denn schon
jetzt melden sich Stimmen, die ursprünglichen düsteren Leerräume seien
vorher eindrucksvoller gewesen als jetzt, nach dem Einbau von
Trennwänden, Zwischenetagen mit ihren zusätzlichen Treppenaufgängen,
voll gestopft mit Säulen, Vorhängen, Kästen, Apparaturen und
Manuskripten, Büchern, Plakaten, Gemälden, Skulpturen und diversem
Schnickschnack, angefangen von Teetassen aus dem 18. Jahrhundert und
rostigen Beschneidungsmessern bis zu Moses Mendelssohns Lesebrille,
durch die der "deutsche Sokrates" blickte, als er seinen Phädon
schrieb, eines der meist gelesenen Philosophiebücher des 18.
Jahrhunderts.
Das Galadiner zur Eröffnung des neuen Jüdischen Museums war eine fein
abgestimmte Staatszeremonie unter Anwesenheit von 850 Gästen. Man hatte
sie wohlbedacht ausgewählt unter der Elite des deutschen politischen
Lebens, unter führenden Geschäftsmännern, Bankiers und Industriellen,
Professoren, Sprösslingen aus alten preußischen Adelsfamilien und einer
Reihe mächtiger und schwerreicher ausländischer Gäste, vorwiegend Juden,
fast alle aus den Vereinigten Staaten.
Noch nie, so zitierte die Berliner Zeitung "Protokollinsider",
war die Gästeliste eines offiziellen Diners mit so viel kalkulierter
Sorgfalt zusammengestellt worden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
druckte die Liste auf zwei ganzen Seiten ab. Als Grund für die
Veröffentlichung gab sie an: Hier habe die neue "Berliner Republik" ihre
erste Vollversammlung abgehalten. Die Zeitung schuf einen - zumindest
für eine Republik, in der es keinen offiziellen Adel gibt - leicht
bizarren, wenn nicht parvenühaften Ton, indem sie gewisse
Wirtschaftstycoons als S. H. (Seine Hoheit?!) bezeichnete, zum Beispiel
S. H. Herr Konstantin Graf von Lambsdorf (Wessling & Berenberg-Gossler),
I. H. seine Frau, oder S. H. Herr Andreas Graf von Hardenberg (Senior
Advisor der Chase Manhattan Bank AG) - als säße der Kaiser immer noch
auf dem Thron und der Erste und Zweite Weltkrieg, auch Hitler, hätten
nie stattgefunden.
Bei so viel Pathos und so vielen zweifellos ernsthaften Bezeugungen der
Reue und der Bewunderung für alles Jüdische konnte man sich nicht des
Gefühls erwehren, dass die neue Republik 50 Jahre nach dem Holocaust die
deutschen Juden praktisch zu Heiligen salbte. In diesen Zusammenhang
passt eine Legende, die Jacob Burckhardt in seiner Kultur der
Renaissance
in Italien erzählt, "eine jener Geschichten, die wahr und unwahr ist,
überall und nirgends". Die Bürger von Siena, schreibt Burckhardt,
wollten einen Mann, der ihrer Stadt einen großen Dienst erwiesen hatte,
angemessen belohnen. Jeden Tag berieten sie, wie man ihn entschädigen
könne. Schließlich befanden sie, dass keine in ihrer Macht liegende
Entlohnung groß genug sei. Zum Schluss erhob sich einer der Männer und
sagte: "Wir bringen ihn um, und dann verehren wir ihn als unseren
Schutzheiligen."
Die zur Eröffnung präsentierte Ausstellung des Museums ist allerdings
enttäuschend. Das liegt zum Teil an dem architektonischen
Prokrustesbett, in das man die Ausstellung gezwängt hat. Daniel
Libeskinds Gebäude soll auf der Musik Schönbergs beruhen (sofern es
wirklich möglich ist, Schönbergs unvollendete Oper Moses und Aaron
"architektonisch zu vollenden", wie Libeskind behauptet). Es mag ein
Meisterwerk der Bildhauerei und Architektur sein; als Museum ist es ein
Albtraum. Es lässt wenig oder nur irritierenden Raum für
Ausstellungsflächen. Große symbolische voids, Leerräume, die den
Verlust symbolisieren, durchschlagen den gesamten Bau vom Untergeschoss
bis zum Dach. An die 3900 Objekte, Installationen, Bilder, elektronische
Medien und pädagogische Hilfsmittel hat man in den übrig gebliebenen
Raum gezwängt. Aber weder der Raum noch die Exponate gehen heil aus
dieser Begegnung hervor. Das Ergebnis ist ein verwirrendes Labyrinth aus
voll gepackten Winkeln und Ecken und eingezogenen Decken, Trennwänden
und Zwischengeschossen, die Libeskinds symbolisches Design
unterminieren, aber eingebaut wurden, um etwas mehr Ausstellungsfläche
zu gewinnen.
Die Ausstellung ist mahnend und didaktisch, aber durchaus im Geist der
Versöhnung, und so sollte es auch sein. Das Konzept folgt nicht der, wie
man sagen könnte: tränenreichen Interpretation jüdischer Geschichte,
zumindest nicht in Bezug auf längere Zeitabschnitte im frühen
Mittelalter. Das Hauptziel liegt im Aufzeigen der tiefen historischen
Wurzeln der Juden in deutschen Landen. Sie waren keine Neuankömmlinge,
sondern hatten hier nicht selten und recht gut in relativer Harmonie mit
ihren Nachbarn aus uralten Zeiten gelebt; eine Volksgruppe, ein
deutscher Stamm wie viele andere - Sachsen, Preußen, Bayern und so
weiter. Nur dass Juden natürlich bereits da waren, bevor es Sachsen,
Preußen und Bayern überhaupt gab. Wahrscheinlich schon während des
Kaiserreichs, bestimmt aber während der Weimarer Republik gab es hier
kein spezifisch "jüdisches Leben" mehr, sondern, wie Gordon A. Craig es
einmal ausdrückte, "eine halbe Million einzelner Juden, die eifrig ihr
eigenes Leben aufbauten" und die, wie die meisten anderen Deutschen,
"ihren Standpunkten folgten, die unter sich verschieden und unabhängig
waren".
Wie so oft in derartigen Ausstellungen gibt es eine Reihe interessanter
Exponate und andere, die einfach nur niedlich sind. Und trotzdem fehlt
mir eine gewisse Spannung: die Spannung zwischen Juden und Nichtjuden,
aber auch die zwischen Juden. Hier und da finden sich Anspielungen auf
den "alten Hass", aber wie und warum eine Minderheit von weniger als
einem Prozent so viel Animosität, Groll, Neid oder eine ans
Pornografische grenzende Neugier wecken konnte, wird so gut wie nicht
dargestellt, geschweige denn erklärt. Tatsächlich ist Deutschland das
einzige westeuropäische Land, in dem es immerhin noch bis ins 19.
Jahrhundert nicht weniger als drei Pogromwellen gab: 1819, 1830 und 1848
(davon griffen einige weit um sich); ferner einen weiteren Ausbruch von
1872 bis 1875, vergleichbar der Hassorgie in Frankreich während des
Dreyfus-Prozesses.
Das alles wird in der Ausstellung kaum reflektiert. Und auch Karl Marx
ist nirgends erwähnt, dafür hingegen weniger bedeutende
Sozialdemokraten. Könnte es sein, dass man ihn übersah, weil er
Antisemit war oder weil die Kuratoren meinten, auch er sei ein bloßer
Betriebsunfall in der jüdischen Geschichte gewesen? Des Weiteren findet
sich in dem Museum nichts zu den innerjüdischen Spannungen und Krisen,
deren es so viele gab. Vor allem die Spannungen zwischen gebürtigen
deutschen Juden und Ostjuden, jenen Einwanderern aus Osteuropa (dem
barbarischen "Halbasien", um die Worte des im 19. Jahrhundert populären
deutschjüdischen Autors Karl-Emil Franzos zu gebrauchen). Und noch
schlimmer: Auch die fortgesetzte Tragödie und Verzweiflung, die gut
integrierte, assimilierte und aufgeklärte Juden nicht selten in einem
bitteren Moment der Wahrheit erfahren mussten, wird kaum erwähnt.
Doch genau das gehörte zum Erfahrungsschatz selbst der assimiliertesten
deutschen Juden. Als ein Beispiel unter vielen sei Berthold Auerbach
genannt, ein persönlicher Freund der Kaiserin und der Herzöge von
Württemberg und Baden, ein berühmter Autor der erfolgreichen
Schwarzwälder Dorfgeschichten, die jeder Patriot mit viel Liebe las.
Auf dem Höhepunkt der antisemitischen Bewegung in den späten 1870er
Jahren kehrte er als geschlagener Mann von einer tumultartigen, von
antisemitischen Ausbrüchen gestörten Sitzung des Preußischen Parlaments
nach Hause zurück. In äußerster Verzweiflung schrieb er in sein
Tagebuch: "Umsonst gelebt und gearbeitet."
Exilerfahrung durch Begehung schräger Böden
Der noch beliebtere Jakob Wassermann, der zu seiner Zeit auf einer
Stufe mit Hermann Hesse und Thomas Mann stand, veröffentlichte 50 Jahre
später, im Jahr 1920, folgenden Stoßseufzer: "Es ist vergeblich, das
Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu
beschwören. Jedes Vorurteil, das man abgetan glaubt, bringt, wie Aas die
Würmer, tausend neue zu Tage ... Es ist vergeblich, beispielschaffend zu
wirken ... vergeblich, die Verborgenheit zu suchen. Sie sagen: der
Feigling, er verkriecht sich, sein schlechtes Gewissen treibt ihn
dazu ... Es ist vergeblich für sie zu leben und für sie zu sterben ...
Sie sagen: er wird seinen Profit schon dabei gemacht haben ... Er ist
ein Jude."
Thomas Mann, etwas zu zungenfertig, versuchte vergeblich, Wassermann
umzustimmen. Der enorme Erfolg von dessen Büchern sei Beweis genug, dass
es keinen nennenswerten Antisemitismus gebe. Wassermann antwortete mit
der Frage, was er, Thomas Mann, wohl empfunden hätte, wenn man aus
seinem Lübecker Hanseatentum ein Misstrauensvotum konstruiert hätte.
Das neue Museum wollte, laut Michael Blumenthal, dem Direktor, kein
weiteres Holocaust-Museum sein. Genau das aber ist das riesige
Untergeschoss, das so belassen wurde, wie Libeskind es schuf. Hier
betritt und verlässt der Besucher das Museum, und das ist zweifellos der
angemessene historische Rahmen, um oben die angenehme Tonbandstimme
Einsteins zu hören, mit leicht bayerischem Akzent, und um die reizenden
Familienporträts und andere Überbleibsel deutschjüdischen Lebens zu
betrachten. Eine andere Frage ist, ob die hermeneutische Tyrannei
schräger Böden, die dazu bestimmt sind, "Exil" körperlich erfahrbar
werden zu lassen, indem sie ein leichtes Schwindelgefühl hervorrufen,
diesem angemessenen historischen Rahmen gerecht wird. Libeskind scheint
zu glauben, dass seine Architektur uns das Übelkeit erregende Gefühl des
unerwarteten Exils nahe bringen kann oder das Entsetzen, wenn man in ein
Konzentrationslager abtransportiert wird. Trotz dieser Anmaßung ist er
offenbar so unsicher, dass er meint, er müsse uns, wo immer wir uns in
diesem Untergeschoss hinwenden, daran erinnern, was wir fühlen sollen,
wo wir innehalten müssen, um uns zu erinnern, und wo, um nachzudenken.
Ich war bestürzt, als ein deutscher Freund sagte, das sei genau das, was
deutsche Besucher erwarteten und auch wünschten. Ich hoffe, dem ist
nicht so.
Ich hatte nicht gedacht, dass der Architekt in diesem Untergeschoss
fast so gefeiert wird wie die Opfer, deren er gedenkt. Hier einige
Inschriften auf den Wänden des Untergeschosses: "Der Architekt Daniel
Libeskind fordert uns zum Nachdenken auf: über den Holocaust und über
die Männer und Frauen, die entkommen konnten, über Kontinuität und die
Menschen, die weiterleben". Und an anderer Stelle: "Sie nähern sich dem
Memory Void, einem Ort zum Nachdenken und Insichgehen. Mit den
Leerräumen stellt der Architekt Daniel Libeskind den Verlust dar, den
die Vernichtung der Juden in der deutschen und europäischen Geschichte
hinterlassen hat".
In Libeskinds Memory Void, einem kathedralenartigen vertikalen Raum,
der mehrere Stockwerke durchbricht, ist der Boden mit einer Installation
des israelischen Künstlers Menashe Kadishman bedeckt. Sie heißt auf
Hebräisch Shalechet - Gefallenes Laub - und besteht aus vielen
einzelnen runden Metallscheiben mit Löchern für Augen, Mund und Nase.
Wir dürfen auf den Gesichtern umhergehen. In dem metallischen Scheppern
auf dem Steinboden sollen wir offenbar die Stimmen der Opfer hören und
uns an sie erinnern. Das Problem bei solchen Installationen ist, dass
sie Gefahr laufen, zu purem Kitsch zu verkommen, je besser es ihnen
gelingt, Wirklichkeiten zu simulieren.
Libeskinds so genannter Holocaust-Turm ist ebenfalls ein hoher,
kegelförmiger Raum mit einem schmalen Schlitz, durch den von oben
dämmriges Licht fällt. Hier besteht der Trick darin, dass nach dem
Betreten des Raums eine schwere Tür hinter dem Besucher zuschlägt. Man
ist allein und fröstelt vielleicht ein wenig (der Raum ist ungeheizt).
Sonst aber fühlt man sich wohl und könnte fast froh sein, den
Menschenmassen draußen entkommen zu sein, wenn der Architekt nicht
gerade darauf hingewiesen hätte, dass so sich die Menschen gefühlt haben
könnten, als sie deportiert wurden und sich in einem Konzentrationslager
wiederfanden. "In diesem Raum sind wir vom Alltag abgeschnitten. Wir
hören Geräusche und sehen Licht, aber die Außenwelt können wir nicht
erreichen. So war es für die Menschen, die vor und während der
Deportation eingeschlossen waren." Diese Anmaßung, durch eine Tür und
ein paar kahle Wände die Verzweiflung eines Deportierten oder gar eines
KZ-Insassen, wenn auch bloß entfernt oder symbolisch, suggerieren zu
können, erschien mir bodenlos arrogant.
Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit
siehe auch: Jaron London -
Deutschlandreise
haGalil onLine 25-10-2001