 |
|

|
|
|
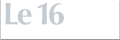
|
|
|

|
|
Wer dachte im Jahr 1949
in Deutschland an Auschwitz? Der Krieg war vor vier Jahren zu Ende gegangen.
Was die Deutschen interessierte, waren der Wiederaufbau und die
Währungsreform. Man blickte nach vorne, oder aber weit zurück, auf
glücklichere Tage. Zum Beispiel auf Goethes 200. Geburtstag, den es in
diesem Jahr zu feiern galt.
Aus diesem Anlass
besuchte auch Thomas Mann, zum ersten Mal nach 1933, das mittlerweile in Ost
und West geteilte Deutschland. Er sprach in Frankfurt am Main und in Weimar
von Goethes großem und gutem "Deutschtum". Das nahe gelegene
Konzentrationslager Buchenwald, jenen Ort, wo noch vor wenigen Jahren das
böse Deutschtum gewütet hatte und immer noch wütete, erwähnte er nicht. Etwa
zur gleichen Zeit war Theodor W. Adorno aus seinem amerikanischen Exil nach
Frankfurt zurückgekehrt und schrieb an seinem Essay Kulturkritik und
Gesellschaft, der seine Berühmtheit einem einzigen, für die deutsche
Literatur nach 1945 folgenschweren Satz verdankt: "Kulturkritik findet sich
der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber: nach
Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch die
Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu
schreiben".
Bereits 1948 war der junge Dichter Paul Celan-Antschel aus Czernowitz in der
Bukowina, nach kurzen Aufenthalten in Bukarest und Wien, in Paris eingetroffen.
Er, der jüdische Dichter, war nur knapp der Vernichtung entkommen, die Deutsche
ihm zugedacht hatten. Seine Eltern waren 1942 deportiert und in einem Lager in
Transnistrien/Ukraine ermordet worden, ebenso wie viele seiner Bekannten und
Verwandten. Jetzt war er allein in der französischen Metropole angekommen und
schrieb Gedichte in deutscher Sprache. Sie war das einzige, so wird Celan Jahre
später bekennen, was ihm inmitten der Verluste geblieben war, jene deutsche
Sprache, in der ihm seine Mutter Verse von Goethe und Schiller vorgesprochen
hatte, und die nun zugleich die Sprache ihrer Mörder war. In keiner anderen
Sprache hätte er ihr und den anderen Ermordeten gedenken können.
"Kunst kommt nicht vom Können, sondern vom Müssen", dieses Wort Arnold
Schönbergs fand Celan Jahre später in Adornos Essay über den Komponisten und
strich es sich an. Auch er hatte keine Wahl: Er musste Gedichte schreiben,
Gedichte in deutscher Sprache. Bereits in Wien war sein erster Gedichtband mit
dem düsteren Titel Der Sand aus den Urnen erschienen - auf schlechtem Papier, in
einer Ausstattung, die dem Dichter missfiel und mit vielen Druckfehlern. Nach
wenigen Jahren wurde das Buch im Auftrag des Autors eingestampft. Die Bilanz:
Neun verkaufte Exemplare und ein Erlös von dürftigen 146 Schilling, davon mehr
als ein Drittel für das Altpapier der vernichteten Bücher. Der Band, der bereits
die Todesfuge enthielt, Celans wohl bis heute bekanntestes Gedicht, blieb - wie
der Autor selbst - vorläufig unbekannt.
Adornos Worte über Gedichte nach Auschwitz wurden von vielen - auch von Celan -
als Verdikt interpretiert. Adornos Satz und Celans Gedichte, vor allem die
"Todesfuge", für uns gehören sie heute wie These und Antithese zusammen. Wer von
Adornos Diktum spricht, denkt auch an Celans Lyrik. Und - auch dies gehört zum
Kontext dieser Texte: Sie nahmen Einfluss auf die Sichtweise des Gegenübers.
Dass Celan mit den Gedichten des Bandes Sprachgitter, die zwischen 1955 und 1958
entstanden waren, ein anderes, ein verändertes dichterisches Sprechen wagt,
daran hat auch der kritische Dialog mit Adorno seinen Anteil. Man vergleiche nur
die Todesfuge mit der ENGFÜHRUNG, dem großen Schlussgedicht des
Sprachgitter-Buches, in dem der Hinweis auf Adorno vielleicht am deutlichsten
ist.
Der Philosoph wiederum hat sein Verdikt auch unter dem Einfluss der Lyrik Celans
langsam zurückgenommen und revidiert. Celan registrierte das sehr genau, wie aus
dem Briefwechsel der beiden hervorgeht, der in den "Frankfurter Adorno-Blättern"
erscheinen wird. Als im Januar 1962 in der Zeitschrift Merkur Adornos Aufsatz
Jene zwanziger Jahre erschien, dankt ihm der Dichter in einem Brief für dessen
letzten Sätze, mit denen "über die Entfernung hinweg, Ihre Person nahe und
ansprechbar" geworden sei. Jene Sätze lauten: "Der Begriff einer nach Auschwitz
auferstandenen Kultur ist scheinhaft und widersinnig, und dafür hat jedes
Gebilde, das überhaupt noch entsteht, den bitteren Preis zu bezahlen. Weil
jedoch die Welt den eigenen Untergang überlebt hat, bedarf sie gleichwohl der
Kunst als ihrer bewusstlosen Geschichtsschreibung. Die authentischen Künstler
der Gegenwart sind die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert."
Adorno war für Celan bereits in den 50er Jahren kein Unbekannter. Die Bücher in
seiner Bibliothek, seine Anstreichungen in Adornos Essays, die damals in allen
wichtigen Literaturzeitschriften erschienen, belegen sein lebhaftes Interesse an
dessen Werk. Ein Interesse, das bei Celan interessanterweise nur noch mit jenem
für Heideggers Schriften zu vergleichen ist. Adorno, das war für Celan der nach
Deutschland zurückgekehrte Intellektuelle, der Freund Benjamins und Scholems,
ein Jude, ein Verbündeter, der über George, Heine, Kafka und Schönberg schrieb
und die Entwicklung der deutschen Nachkriegsgesellschaft kritisch begleitete. Es
musste ihm ungeheuerlich erscheinen, dass gerade Adorno ihn in Frage stellte.
Ihn, den Dichter, der Gedichte nach Auschwitz schrieb, dessen Gedichte, allen
voran die Todesfuge, zu den frühesten Zeugnissen einer dichterischen
Auseinandersetzung mit der Shoa in Deutschland zählten.
Im Sommer 1959 sollte es zur ersten Begegnung der beiden kommen. Peter Szondi
hatte sich bemüht, ein Treffen in Sils-Maria zu arrangieren. Am 22. Juli 1959
war Celan mit seiner Frau Gisèle und seinem Sohn Eric in dem schweizerischen
Gebirgsort angekommen. Szondi erinnert sich später "an die Spaziergänge mit
Celan in Sils, die langen Minuten des Schweigens vor der fremden Natur". Aber
nach kurzem Aufenthalt, noch bevor Adorno eintrifft, reist die Familie nach
Paris zurück. Dies ist der karge Rahmen jener "versäumten Begegnung im Engadin",
die so reiche poetische Früchte trug. Kaum nach Paris zurückgekehrt schreibt
Celan sein Prosastück Gespräch im Gebirg, das er später als "ein Mauscheln"
zwischen sich und Adorno bezeichnete. Es ist ein besonderer und zugleich
sonderbarer Text, dem innerhalb des Celanschen Gesamtwerkes nichts
Vergleichbares zur Seite gestellt werden kann. Wer den Weg des am Stock gehenden
Juden durchs Gebirg aufmerksam begleitet, der findet, unter der Oberfläche
verborgen, immer wieder Hinweise auf literarische Texte, die für Celan wichtig
waren. So erinnert seine Prosa nicht von ungefähr an Büchners Lenz, an Kafkas
Der Ausflug ins Gebirge, an Nietzsches Zarathustra und an Bubers Gespräch in den
Bergen.
Vordergründig ist diese Prosaerzählung, was ihr Titel verspricht, ein Gespräch
im Gebirge. Ein Gespräch allerdings zwischen zwei Juden, ein Gespräch über
Sprache. Genauer: über die deutsche Sprache, die einem Juden nach Auschwitz
bleibt, der in der Sprache der Mörder, mit all ihren Abgründen und Tiefen,
Untergängen und Verwerfungen, Gedichte schreiben und sprechen muss. Die
Protagonisten der Erzählung blieben freilich nur im Text anonym. Freimütig
bekannte Celan jedem, der es wissen wollte, dass er hier fiktiv, aber
beziehungsreich, das Zusammentreffen des "Juden Klein" Celan mit dem "Juden
Groß" Adorno geschildert hatte. Damit war deutlich und eindeutig darauf
hingewiesen, dass diese Prosaerzählung eine Fortsetzung der zwischen den Zeilen
ausgetragenen Kontroverse zwischen dem Dichter und dem Philosophen mit
poetischen Mitteln war. Sie ist bis dahin die deutlichste öffentliche
Stellungnahme Celans zu Adornos Diktum. Der Text ist jedoch auch eine
poetologische und damit für Celan zugleich eine sehr persönliche
Bekenntnisschrift, in der er seiner Daten eingedenk bleibt.
Es ist kein Zufall, dass Celan in seiner Bücherpreis-Rede an einer
entscheidenden Stelle von jener "versäumten Begegnung im Engadin" spricht und
sie mit einem Stimmen-Gedicht aus dem Band Sprachgitter in Beziehung setzt,
bevor er schließlich das sein Leben und Dichten bestimmende Datum nennt: "Ich
hatte mich, das eine wie das andere Mal, von einem ,20. Jänner', von meinem ,20.
Jänner', hergeschrieben. / Ich bin . . . mir selbst begegnet." Vom "20. Jänner"
her, das meinte den 20. Januar 1942, den Tag der Wannsee-Konferenz, an dem die
Vernichtung der europäischen Juden bürokratisch und exakt von den Fachmännern,
den "Meistern" des Völkermords aus Deutschland beschlossen wurde. Auch an dieser
Stelle der Rede war Adorno der Ansprechpartner.
In Gespräch im Gebirg expliziert Celan das Wesen seiner präzisen "grauen"
Sprache, in der er die neuen Gedichte des Bandes Sprachgitter verfasst hatte.
Und er tut dies in Anlehnung an das "Jiddische", jenes "Judendeutsch", das dem
Hochdeutschen so fremd und zugleich so verwandt ist. Celan hatte dafür seine
Gründe. "Jiddisch", das war die Alltagssprache vieler, vor allem der
osteuropäischen Juden, mit deren Vernichtung auch diese Sprache ausgelöscht
werden sollte. Es war das Deutsch der Opfer, frei von jeglicher Schuld, ohne
falsche Töne und missbrauchte Wörter, Stigma und zugleich Zeugnis einer Liebe
zur deutschen Sprache, der Sprache der Mörder. Denn Celans Gespräch im Gebirg
ist in gewisser Weise auch sein Bekenntnis zum Judentum. Ein öffentliches
Bekenntnis, zu dem es ihn in einer Zeit drängt, als er bereits bei einer Lesung
in Bonn mit einer antisemitischen Zeichnung verspottet wird und ihn Hans Egon
Holthusen, ein in Deutschland angesehener Lyriker und Essayist mit
SS-Vergangenheit, als "Fremdling und Außenseiter der dichterischen Rede"
bezeichnet, dessen Metapher von den "Mühlen des Todes", künstlich und daher
"gänzlich tot" sei. Die "Mühlen des Todes" aus dem Gedicht Spät und Tief waren
jedoch alles andere als eine künstliche Metapher, es war der Titel eines
Dokumentarfilms über die deutschen Konzentrationslager, den die Alliierten kurz
nach dem Krieg in vielen deutschen Kinos zeigen ließen. Zudem verleumdete Claire
Goll, die Witwe des Dichters Ivan Goll, Celan bereits seit Jahren als Plagiator.
Celan setzt viele Hoffnungen in die Publikation des neuen Gedichtbandes
Sprachgitter. Sie erfüllten sich nicht. Die neuen Gedichte stießen bei vielen
Kritikern auf Unverständnis. Im Oktober 1959, das Gespräch im Gebirg war bereits
geschrieben, erschien die Rezension Günter Blöckers, für den die Todesfuge oder
die ENGFÜHRUNG nichts als "kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier"
waren, deren Metaphernfülle nicht der Wirklichkeit abgewonnen sei. Celan habe
"der deutschen Sprache gegenüber eine größere Freiheit als die meisten seiner
dichtenden Kollegen", was wohl "an seiner Herkunft" liege. Diese Kritik musste
Celan als Versuch eines "Rufmordes" erscheinen - an ihm und an jenen, derer er
in seinen Gedichten gedenkt. Noch am gleichen Tag als er die Blöcker-Rezension
zum ersten Mal liest, sendet er seinem Lektor Rudolf Hirsch das Gespräch im
Gebirg und schreibt dazu: "Hier kommt die kleine Prosa, die ich nach meiner
Rückkehr aus der Schweiz schrieb, Anfang August. Der Aufsatz von Blöcker - er
könnte auch von Goebbels sein - zeigt, dass sie ‚stimmt'. Auch das Judendeutsch,
in dessen Licht auch der Titel steht, ist richtig¨."
Als Celan Adorno im Mai 1960, kaum zwei Wochen nachdem er von Hermann Kasack
darüber informiert worden war, dass ihm die Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung in diesem Jahr den Büchner-Preis verleihen wolle, den Prosatext
zuschickt, schreibt er in seinem Begleitbrief: "Hier kommt nun, mit meinem
herzlichen Dank, die kleine, zu Ihnen nach Sils hinaufäugende, Prosa, von der
ich Ihnen in Frankfurt erzählte. (Seltsam, dass sie sich jetzt als zur
‚Vorgeschichte' meines Büchner-Preises gehörend herausstellt . . .) Es ist schon
der Titel, ‚judendeutsch'.. Es ist - assumons donc ce que l'on nous prête! -
etwas durchaus Krummnasiges . . . an dem das Dritte (und wohl auch das Stumme)
vielleicht wieder gerade werden kann. Ob es sonst noch etwas ist? Erworbener und
zu erwerbender Atavismus vielleicht, auf dem Weg über die Involution erhoffte
Entfaltung . . . Ob es Ihnen gefällt? Ich wüßte es nur allzu gerne!" Adorno
antwortet prompt: "lassen Sie heute mich Ihnen nur für Ihr höchst merkwürdiges
und hintergründiges Prosastück aufs herzlichste danken. Natürlich wäre es die
bare Unverschämtheit, wenn ich beanspruchen wollte, es etwa schon ganz mir
zugeeignet zu haben, aber ich bin von der Sache außerordentlich beeindruckt. In
welcher Richtung, zeigt Ihnen vielleicht am ehesten ein Zitat aus dem letzten
Kapitel meines Mahlerbüchleins an: ‚In der dialogisierenden Anlage des Satzes
erscheint sein Gehalt. Die Stimmen fallen einander ins Wort, als wollen sie sich
übertönen und überbieten: daher der unersättliche Ausdruck und das
Sprachähnliche des Stückes': Es will mir scheinen, als wäre damit wirklich in
die Lyrik ein Element aus der Musik hereingenommen, das es in dieser Weise zuvor
nicht gegeben hat, und das mit dem Klischee des musikalischen Wesens der Lyrik
nicht das mindeste zu tun hat." Das Einverständnis zwischen Celan und Adorno war
niemals größer als in diesem kurzen Dialog über das Prosastück. Nicht nur, dass
Adorno Celans Text zur Lyrik zählte, er nahm den poetischen Text auch als
poetologische Äußerung wahr. Gerade erst hatte Celan in seiner "Antwort auf eine
Umfrage der Librairie Flinker" davon gesprochen, dass die "Musikalität" der
"graueren" Sprache, in der er seine neuen Gedichte schrieb, "nichts mehr mit
jenem ‚Wohlklang' gemein hat, der noch mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder
minder unbekümmert einhertönte". So hatte das fiktive Gespräch im Gebirg -
zumindest für kurze Zeit - zu einer wirklichen Begegnung geführt.
Doch der Annäherung folgte erneut eine Entfremdung, die sicher viele Ursachen
hat. Eine, und nicht die unwesentlichste, wird in Adornos Verhalten während der
so genannten Goll-Affäre zu finden sein. Von Adorno, dem Juden und
"Geschwisterkind", erwartete sich Celan Solidarität und Beistand in seinem Kampf
gegen die Verleumder. Doch Adorno verhielt sich zurückhaltend und war offenbar
irritiert über die Reaktionen des Dichters, der die Anschuldigungen und
Unterstellungen als eine antisemitische Kampagne verstanden wissen wollte. Auch
das Buch über Celans Gedichte schrieb er nicht, das er dem Dichter versprochen
hatte und dessen Erscheinen Celan ungeduldig erwartete. Mehr als ein paar
Aufzeichnungen in der Ästhetischen Theorie und einige wenige Notizen in seinem
Sprachgitter-Exemplar haben sich zu diesem Plan nicht erhalten. Wenige Jahre
später gestand Celan in einer Widmung an seinen Wiener Freund Reinhard Federmann
seine Enttäuschung über den Philosophen ein. Das Gespräch im Gebirg sei in
Erinnerung an Sils Maria geschrieben, "wo ich den Herrn Prof. Adorno treffen
sollte, von dem ich dachte, dass er Jude sei . . . - und Friedrich Nietzsche,
der - wie Du weißt - alle Antisemiten erschießen lassen wollte". Gelegentlich
kritisierte er auch, dass Adorno den Namen seiner katholischen Mutter angenommen
hatte, den Namen seines jüdischen Vaters "Wiesengrund" aber verschwieg und mit
"W". abkürzte.
Auch sein Verdikt hatte Adorno bislang nicht zurückgenommen. In den Materialien
zu Atemwende (1967), dem ersten Celan-Buch, das im Suhrkamp Verlag erschien, in
dem auch Adorno seine Werke zu publizieren pflegte, findet sich folgende Notiz:
"Kein Gedicht nach Auschwitz (Adorno): was wird hier als Vorstellung von
‚Gedicht' unterstellt? Der Dünkel dessen, der sich untersteht hypothetisch -
spekulativerweise Auschwitz aus der Nachtigallen- oder Singdrossel-Perspektive
zu betrachten oder zu berichten". Deutlicher hat sich Celan an keiner anderen
Stelle zu Adornos Verdikt geäußert. Gegen eine ästhetische Theorie, die für ihn
aus der "Nachtigallen- oder Singdrossel-Perspektive" auf Auschwitz schaute,
setzt Celan den "unter dem besonderen Neigungswinkel seiner Existenz"
sprechenden Dichter, der Gedichte schreibt, die ihrer Daten eingedenk sind.
Dennoch brach die Verbindung zwischen Celan und Adorno nicht ab. Trotz aller
Meinungsverschiedenheiten gab es auch Verbindendes. Der letzte erhaltene Brief
Adornos an Celan endet mit dem Hinweis auf "die beglückende Nachricht, dass
Ihnen die Negative Dialektik etwas gesagt hat". In Adornos Schrift stehen die
Sätze: "Das perennierende Leiden hat soviel Recht auf Ausdruck wie der
Gemarterte zu brüllen; darum mag falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein
Gedicht mehr sich schreiben. Nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage,
ob nach Auschwitz noch sich leben lasse". Paul Celan, der am 23. November 80
Jahre alt geworden wäre, hat 1970 die Frage für sich mit seinem Selbstmord in
der Seine beantwortet
[
document info ]
Copyright © Frankfurter Rundschau 2000
Erscheinungsdatum 25.11.2000
haGalil onLine
29-11-2000
|