Philosoph und Rabbiner,
Jerusalem
Geb. 1916 in Halle
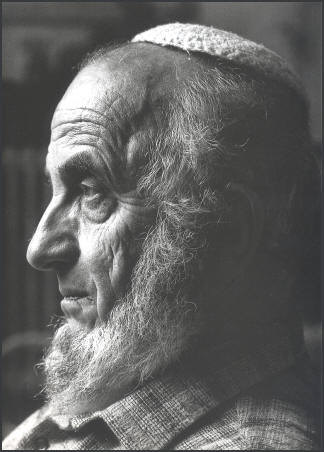
HK: Herr Professor Fackenheim, gibt es in Ihrer Kindheit und Jugend, in
Ihrer Familiengeschichte vielleicht auch schon, Schlüssel für das, was
später Ihre Arbeit und Ihr Denken bestimmt hat?
EF: Unsere Familie hatte schon lange als nichtassimilierte jüdische
Familie in Deutschland gelebt, in Hessen von der väterlichen Seite her, in
Schlesien von der mütterlichen, und dann eben in Halle, wo mein Urgroßvater
schon Rabbiner war. Mein Vater hat sogar einmal versucht, einen Stammbaum
aufzuzeichnen, aber der ist dann später mit allem anderen verlorengegangen.
Wir haben damals die »Assimilanten« ziemlich verachtet Andererseits waren
wir selber ja auch nicht orthodox. Wir haben eben das liberale Judentum als
unseren Standort gesehen und dachten, es hatte in Deutschland einen festen
Platz Damit haben wir uns gewaltig geirrt, aber so dachten wir damals.
Die jüdische Gemeinde in Halle war eine kleine, der Rabbiner war nicht sehr
inspirierend. Er hat viel gewußt, aber man hatte den Eindruck, daß er dort
mit den Jahren etwas versauert war. Trotzdem waren für mich als Kind die
religiösen Eindrucke sehr stark. Das lag auch an der Musik, der jüdischen
religiösen Musik, die mich damals tief beeindruckt hat. Die Reden des
Rabbiners waren gelehrt und langweilig. Aber vielleicht besser, als wenn sie
spannend, aber nicht gelehrt gewesen wären. Sie hatten Substanz. Als ich
anfing, mich für die jüdische Religion zu interessieren, wurde der
langweilige Mensch plötzlich interessant, denn er wußte sehr viel von der
Tradition, nur wollte es keiner hören. Das ist sehr schlecht für einen
Menschen. Wenn er am Rabbinerseminar in Berlin unterrichtet hätte, wäre er
ein ganz anderer Mensch gewesen. Er hat die Grundideen klar dargestellt.
Ich habe seither nie wieder eine Synagoge gefunden, wo ich mich wirklich
zu Hause gefühlt habe. Die Musik war anders, die Tradition war anders. In
solchen Dingen ist man von der Kindheit geprägt. Diese deutsch jüdische
Kultur ist dann untergegangen. Die Tragik, mit der alles geendet hat, zeigt
sich an der Bibelübersetzung von Buber und Rosenzweig. Meiner Meinung nach
war Rosenzweig der letzte große deutsche Jude. Was der Ihnen zu sagen hatte,
wenn er heute noch leben wurde, wäre tiefer als alles andere. Wenn
Rosenzweig gesagt hat, man solle Bachmusik in die Synagogen bringen - das
wäre eine gewaltige Synthese gewesen. Rosenzweig und Buber wollten die
deutschen Juden zum Judentum zurückbringen, aber es war ja fraglich, ob die
alle Hebräisch lernen würden. So wollten sie, um den hebräischen Geist
dennoch vermitteln zu können, die Bibel ins Deutsche übersetzen. Das taten
sie auch. Als sie mit der Übersetzung fertig waren, gab es keine deutschen
Juden mehr. Nehmen Sie das als ein Symbol der Tragik dessen, was damals
passierte. Die Nazis haben nicht nur deutsche Juden ermordet, sondern auch
das deutsche Judentum, wie es gewesen war. Wie es gewaltig angefangen hatte
mit Moses Mendelssohn und wie es sich auch noch in Heine ausdruckte, der
hundertprozentiger Deutscher und hundertprozentiger Jude sein wollte und
dadurch einfach zerrissen wurde - und der übrigens immer noch mein
Lieblingsdichter ist.
HK: Was liegt in dem Wort Heimat für Sie für eine Bedeutung?
EF: Heimat, das gibt es nicht mehr. Ich kann das Wort nicht mehr
benutzen. Die Nazis haben das Wort zerstört. Sie haben soviel zerstört.
Als ich jetzt wieder einmal in Berlin war, habe ich gesehen, daß es die
Kantstraße immer noch gibt. Die Straßennamen sind noch dieselben, aber die
alte Kultur scheint verschwunden zu sein. Ich war in Halle noch ganz
selbstverständlich auf demselben Gymnasium wie mein Vater vor mir. Wir
hatten sogar zum Teil dieselben Lehrer. Und später, 1939, als ich schon in
Sachsenhausen gewesen war und noch eine Sechswochenfrist hatte, das Land zu
verlassen, als möglichst niemand mit mir zusammen gesehen werden wollte, da
hat mein Griechischlehrer mich zu sich nach Hause eingeladen. Er hatte zwei
gewidmete Exemplare von Martin Bubers »Königtum Gottes«, eins für sich
selbst, eins für mich. Und er hat mir gesagt, Sie müssen jetzt weg, aber Sie
müssen mir versprechen, wieder zurückzukommen. Deutschland wird zerstört
werden, und wir brauchen solche Leute wie Sie, um es wieder aufzubauen.
Ich habe ihm damals geantwortet, daß ich ihm das zwei Jahre früher noch
versprochen hatte. Daß ich aber inzwischen wußte, daß das jüdische Volk mich
wohl dringender brauchen würde als das deutsche. Auch mir war damals schon
völlig klar, daß Deutschland zerstört werden wurde, es ist verrückt. Wenn
ich heute trotz allem überhaupt noch von Heimat reden kann, dann meine ich
damit Jerusalem. Bis zum Sechstagekrieg hätte ich wohl noch gesagt Kanada
sei meine Heimat. Aber die drei Wochen vor dem Krieg waren für mich eine
dramatische Erfahrung, für mich und auch für meine Frau. Ich habe mir damals
gedacht, wenn noch ein zweiter Holocaust passiert, dann überlebe ich das
nicht. Möchte es auch gar nicht überleben. Und was hat die anständige Welt
damals getan? Gar nichts. So sind wir letzten Endes wirklich aus
Pflichtgefühl hierhergekommen.
HK: Bedeutet, jüdisch zu sein, zum Judentum zu gehören, für Sie eine
besondere Pflicht?
EF: Ja. Das war schon immer so. Ich möchte sagen, das Pflichtbewußtsein
war sehr groß. Dabei war es erst einmal sozusagen negativ. Meine
unmittelbare Reaktion auf 1933 war die: Es muß auf diesen beispiellosen
Angriff von jüdischer Seite eine Antwort geben. Das war anfangs mein Motiv,
das Judentum zu studieren. Erst mit den Jahren fand ich eine ganz gewaltige
Tiefe darin.
Die Juden haben sich wohl in jeder Generation gefragt: Wieso soll man
einfach weitermachen? Und jeweils fand man die Antwort in einer immer wieder
neuen Erfahrung der Bibel. Als Cyrus kam und den babylonischen Juden sagte:
Ich habe euch befreit, ihr könnt nach Jerusalem zurückkehren - wieso taten
sie es? Sie waren doch nicht mehr die ursprünglich in die Gefangenschaft
Geführten, sondern deren Kinder und Enkel. Wieso sind sie dennoch
zurückgegangen? Ich würde sagen: Das Hauptmotiv war eine gewisse Treue. Sie
hatten Jerusalem nicht vergessen. Es wäre sicher bequemer gewesen, in
Babylonien zu bleiben. Viele haben es ja auch getan. Aber das Judentum ist
eben doch immer wieder gelebt worden.
Der ganze Jüdische Kalender, der mich schon als Kind beeindruckt hat.
Jeder Freitag ist ein Wiedererleben. Die Jom Kippur-Erfahrung war es, die
Rosenzweig dazu bewegt hat, nicht zum Christentum überzutreten. Und bei mir
war es, auch schon in der Kindheit, ähnlich. Ein Grund zum Beispiel, warum
ich lernen wollte, war, daß mein Vater zwar in gewisser Weise fromm war,
aber nicht viel gewußt hat. Er hat gelesen, aber nicht verstanden, was er
gelesen hat. Er konnte auch nicht genug Hebräisch. Und da dachte ich: Wenn
mein Vater derartig treu ist, daß er das liest, ohne es zu verstehen,
wieviel mehr kann man da finden, wenn man es wirklich versteht. Und ich habe
ungeheure Sachen gefunden.
HK: Und wenn Sie den Begriff der Pflicht mehr auf Ihr Leben beziehen?
EF: Da ist dann auch Neigung dabei. Dieser Kantische Dualismus von
Pflicht und Neigung ist hier eigentlich gar nicht anwendbar. Denn was die
Nichtjuden so selten verstehen, und das geht schon aufs Neue Testament
zurück, daß das Gesetz nicht entwürdigt, überhaupt keine Last bedeutet. Der
Jude freut sich des Gesetzes. Wobei »Gesetz« gar keine so gute Übersetzung
von »Mizwah« ist. Jeden Tag betet man, dankt man Gott, daß er Israel
gesegnet hat durch die Gesetze. Das hört sich nicht an wie eine Last. Nun
gibt es die Frage: Was ist besser? Wenn man das Gesetz erfüllt, weil man es
gerne hat, oder wenn man das Gesetz erfüllt, weil es das Gesetz ist? Und die
Antwort ist: das letztere. Denn dann tut man es um Gottes willen. Wenn man
es nur gerne tut, dann ist es lediglich eine Zeremonie.
HK: Was, glauben Sie, ist der Grund dafür, daß in den letzten beiden
Jahrhunderten so viele europäische Juden es ganz besonders im Geistesleben
zu Rang und Namen gebracht haben?
EF: Ich finde es richtig, was Leo Baeck zu diesem Thema gesagt hat. Der
Grund sei ein »zwiefacher«, meinte er. Zum einen hat nach der
jahrhundertelangen Ghettoverfolgung das erste freiere Atmenkönnen eine ganz
gewaltige Begeisterung hervorgebracht. Zum zweiten hatte es das Leben im
jüdischen Ghetto an sich, daß dort eine ungeheure Energie auf Lernen und auf
Studieren verwendet wurde. Diese, man kann sagen, unnatürliche Konzentration
auf das Lernen, das war der Widerstand der Juden im Ghetto gegen die
Verfolgung. Und wenn man das nicht versteht, versteht man überhaupt nichts.
Als ich damit anfing, den Talmud zu studieren, da wußte ich, wenn man das
wirklich alles lernen will, dann muß man sein ganzes Leben damit zubringen,
und das wollte ich erst einmal nicht. Ich empfand das als eine Last. Erst
nach Jahren habe ich verstanden, daß die ungeheure Gelehrsamkeit, die in den
Talmud Eingang gefunden hat, aufgestaute Energie war.
HK: Was hat sich dadurch geändert, daß es für ein Volk, von dem man fast
sagen möchte, es sei an die Zersplitterung und die Beschränkung schon
gewöhnt gewesen, jetzt doch ein Land gibt, in dem es Majorität besitzt und
Staatsnation ist?
EF: Das scheint mir von einer Bedeutung zu sein, die man noch gar nicht
ganz begriffen hat. Denn die Diaspora hat zwar viele positive Effekte
gehabt, aber auch zweifelhafte und schlechte. Als Kind wurde mir
beigebracht, daß, als der erste jüdische Staat von den Römern zerstört
wurde, dies in einem höheren Sinne ein Segen gewesen sei, »a blessing in
disguise«, wie man auf englisch sagt. Es sei zwar fürchterlich, aber doch
letztlich ein Segen gewesen. Der größte deutsch-jüdische Philosoph vor
Rosenzweig, Hermann Cohen, hat das gesagt. Es sollte bedeuten, daß, wenn das
jüdische Volk nicht mehr politisch gebunden, wenn es universal sei, es seine
Mission besser erfüllen könne. Nun, das scheint mir in der Retrospektive
falsch zu sein. Die Machtlosigkeit ist natürlich ein Segen, insofern, als
man nicht auf andere Leute schießen muß. Aber sie kann auch bedeuten, daß
auf einen selbst geschossen wird, ohne daß man sich wehren kann. Nie waren
Juden so hilflos wie während des Holocaust. Da fuhren die Züge nach
Auschwitz, und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Ich bin der festen
Überzeugung, daß, wenn nach dem Holocaust kein jüdischer Staat entstanden
wäre, die Demoralisierung so groß gewesen wäre, daß es über- haupt keine
Juden mehr geben würde, heute schon. Mit Ausnahme einiger Orthodoxer, für
die überhaupt nie etwas passiert.
Manche sagen, es sei etwas Schreckliches, einen Staat zu haben. »Jetzt
schießen wir selber auf andere Leute!« Buber hat das gesagt. Aber wäre es
nicht schlimmer, wenn man andere bitten müßte, auf jene Leute zu schießen?
Das sind Fragen der Staatsphilosophie, und mit ihr steht es ja heute überall
sehr schlecht. Nach dem, was passiert ist, daß die Verbrecher das Gesetz
übernommen haben. Deutschland war ein Rechtsstaat. Aus Deutschland kamen all
die großen Rechtsphilosophen, mit Hegel an der Spitze. Amerika, das ein
gesegnetes Land ist, hat mit Jefferson begonnen. Aber im Vietnamkrieg wußte
man plötzlich auch nicht mehr, was eine Staatsphilosophie ist. Wann schießt
man, wann schießt man nicht? Die Staatsphilosophie befaßt sich mit den
meiner Meinung nach schwierigsten Fragen überhaupt. Und dann kamen auch noch
die Kommunisten dazu, die dachten, es könne wohl kein großer Fehler sein zu
schießen, solange man nur ein Proletarier ist. Das ist ein schreckliches
Jahrhundert, in dem wir leben. Und ausgerechnet in diesem Jahrhundert müssen
die Juden ihre eigene jüdische Staatsphilosophie entwickeln. Das ist eine
ungeheure Aufgabe.
HK: Eine Frage, über die Sie selbst geschrieben haben: Wie soll man noch
glauben, wenn man erfahren hat, was in den Konzentrationslagern geschehen
ist? Warum hat Gott das zugelassen?
EF: Das ist natürlich die schwierigste Frage der jüdischen Theologie
heute. Als ich das Buch geschrieben habe, von dem Sie sprechen, habe ich
diese Frage bis aufs letzte Kapitel verschoben. Ich wollte nicht gleich im
ersten Kapitel darauf kommen. Ich haue Angst, jeder, der merkt, daß ich die
Frage nicht beantworten kann, würde sich vom Judentum abwenden. Das wollte
ich nicht. Schließlich hatte ich das Buch fertiggeschrieben bis auf diese
Frage. Ich wußte aber, daß man sie letztlich doch nicht vermeiden kann -
sonst hätte ich Hamlet ohne den Prinzen von Dänemark geschrieben.
Ich bin dann eines Tages hier in Jerusalem spazierengegangen und traf
einen jungen Menschen, der mich grüßte. Ich sage: »Ich weiß jetzt im Moment
gar nicht... Kenne ich Sie?« Und er: »Ja ja. Sie haben mal bei uns
gesprochen, ich war einer Ihrer Hörer.« Wir sind dann ins Gespräch gekommen,
und ich habe ihn gefragt, was er denn im Moment so treibe. Er habe gerade
seine Doktorarbeit fertiggestellt, über Rabbi Shapiro. Ich wußte, das war
der letzte chassidische Rabbi im Warschauer Ghetto. Predigten, die er
gehalten hatte, waren gefunden und veröffentlicht worden.
Ich bat dann den Studenten, er möge mir von diesen Predigten ein bißchen
erzählen. Nun, um das zusammenzufassen: Dieser Rabbi Shapiro hatte sich nie
auf diejenigen Juden im Ghetto eingelassen, die sagten, die Verfolgungen
durch die Nazis seien eine Strafe für ihre Sünden. Jahrelang blieb er dabei,
das seien Katastrophen, denen man keinen Sinn geben könne. So etwas sei
früher schon passiert, und die Juden hätten es immer überlebt. Aber nach
1942 hat er das nicht mehr gesagt. Seine Predigten änderten sich. Und eine
davon ist jetzt der Schluß meines Buches.
Sie wissen ja vielleicht, daß es eine der Aufgaben des Talmud ist, die
Bibel zu erklären. Widersprüche in der Bibel aufzulösen. Und nun gibt es da
zwei solche Stellen, eine bei Jeremias, wo steht, daß Gott in seinem Zimmer
weint, und eine andere, wo es heißt: Es gibt Jubel in Gottes Palast. Der
Talmud will jetzt wissen, wie es möglich ist, daß beides wahr ist. Und seine
Antwort lautet: Das eine geschieht im äußeren Zimmer und das andere im
inneren Zimmer.
Normalerweise würde man nun annehmen, daß die Freude im inneren Zimmer
ist, daß im Himmel das Leiden der Welt überwunden ist. Aber der Talmud sagt
das Gegenteil. Warum?
Rabbi Shapiro fängt da an, wo der Kommentar, ein mittelalterlicher
Kommentar, aufhört. Und er sagt: Im äußeren Zimmer ist Jubel, weil Gott sich
dort einfach verstellt, als ob diese ganze Sache ihn nichts angeht. Wieso
aber weint Gott gerade im inneren Zimmer, wo wir nicht hingelangen? Da Gott
unendlich ist, ist sein Leiden auch unendlich. Nun weiß Gott: Wenn sein
Leiden unendlich ist, dann darf es die Welt nicht berühren, denn sonst würde
die Welt zerstört werden. Darum ist es aus Liebe, daß Gott sich von uns
zurückgezogen hat, um in der Einsamkeit zu jammern. Und der Rabbi fügt noch
hinzu: Aber wir wollen doch das Leiden Gottes teilen. Können wir zu ihm
durchdringen?
Damit hört er auf. Das ist die ungeheuerlichste Antwort, die ich auf
diese Frage je gefunden habe: Daß Gott die Welt so geliebt hat, daß er sich
von ihr zurückgezogen hat, damit sie nicht von seinem Leiden zerstört werde.
HK: Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie mit dem Judesein eine bestimmte
Verpflichtung verbinden. Haben auch die Deutschen, die heute leben, eine
besondere Pflicht?
EF: Die Deutschen der jüngeren Generation sind nicht schuldig, das ist
keine Frage. Aber sie haben eine besondere Last zu tragen, ob sie wollen
oder nicht. Zumindest für einige ist auch selbstverständlich, daß man,
obwohl man keine Schuld hat, doch Verantwortung hat. Die deutsche Jugend
trägt die Verantwortung dafür, daß die Zukunft anders wird, als die
Vergangenheit war. Ich glaube, daß es wieder deutsche Denker geben muß, die
fragen: Was ist denn passiert in Deutschland, das mit Dichtern und Denkern,
von Kant bis Hegel begann und mit Hitler als Denker endete? Wie ist so ein
unvergleichliches Versagen möglich wie das von Heidegger, der vielleicht der
größte Philosoph des zwanzigsten Jahrhunderts war und bis zu seinem Tod
nicht ein einziges Wort über den Holocaust geschrieben hat? Ich kann nicht
verlangen, daß jeder Mensch sich mit diesen Dingen beschäftigt. Aber es
sollte zumindest einen einzigen Denker geben, der sagt: Ich habe keine
andere Aufgabe, als diese Geschichte durchzudenken, noch einmal, vom Anfang
bis zum Ende, um zu sehen, was da wirklich passiert ist. Denn was durch
Denken geschehen ist, muß durch Denken überwunden werden.
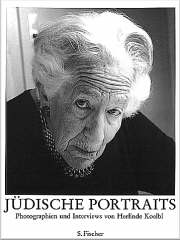
Weitere Informationen
zu
diesem Buch |
Quelle:
Jüdische Portraits
Photographien und Interviews von Herlinde Koelbl
Neuausgabe. Mit 80 s/w-Abbildungen
S. Fischer Verlag
[BESTELLEN]
Achtzig Photographien und Gespräche
portraitieren die letzte Generation jüdischer Deutscher, die noch in das
intellektuelle und geistige Klima der deutsch-jüdischen Symbiose
hineingeboren wurde - und die dann dessen Zerstörung erleben musste.
|