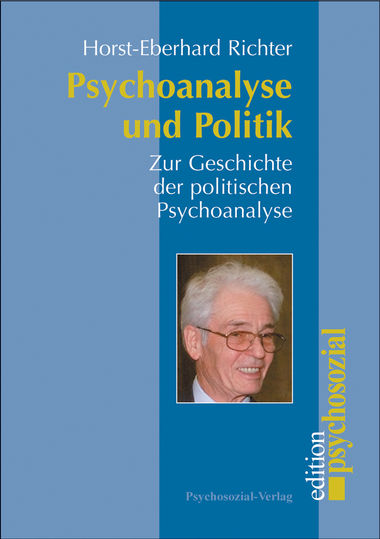Als Sigmund Freud 1910 mit einer kleinen Anzahl von Mitstreitern die »Internationale Psychoanalytische Vereinigung« gegründet und somit die organisatorischen Grundlagen für eine Ausbreitung seiner beunruhigenden Erkenntnisse gelegt hatte, benannte er offen die massiven Gegenkräfte, die sich seinen Bemühungen entgegenstellen würden. Er betrachtete diese Gegenkräfte nicht als böswillig, sondern als notwendig…
Von Roland Kaufhold
Dementsprechend formulierte er: »Die Gesellschaft wird sich nicht beeilen, uns Autorität einzuräumen. Sie muß sich im Widerstand gegen uns befinden, denn wir verhalten uns kritisch gegen sie; wir weisen ihr nach, daß sie an der Verursachung der Neurosen selbst einen großen Anteil hatte«, um anschließend mit »kühner Selbstsicherheit» (5. 19) hinzuzufügen:
»Die einschneidendsten Wahrheiten werden endlich gehört und anerkannt, nachdem die durch sie verletzten Interessen und die durch sie geweckten Affekte sich ausgetobt haben. Es ist bisher noch immer so gegangen, und die unerwünschten Wahrheiten, die wir Psychoanalytiker der Welt zu geben haben, werden dasselbe Schicksal finden. Nur wird es nicht sehr rasch geschehen; wir müssen warten können.» (S. 19 f., Hervorhebung d. Verf.)
Horst-Eberhard Richter stellt diese Äußerung Freuds an den Ausgangspunkt seines sehr lebendig geschriebenen Buches. Der Titel »Psychoanalyse und Politik» verweist auf seine kulturkritische Intention. Er unternimmt den weitgreifenden Versuch, sowohl historisch verwurzelte als auch aktuell gesellschaftlich bedingte Tendenzen zu eruieren, die uns zu bedenklichen, letztendlich tendenziell entmündigenden Anpassungsleistungen an bestehende Verhältnisse veranlassen. Seine Grundhaltung ist hierbei von Behutsamkeit geprägt, gepaart mit ansteckendem Engagement.
Zum Inhalt: Die ersten Kapitel sind historisch orientiert. Von den Studien Fallends, Reichmayrs, und Mühlleitners ausgehend entfaltet Richter das emanzipatorische, sozialistisch orientierte Bemühen zahlreicher Pioniere der Psychoanalyse sowie der Psychoanalytischen Pädagogik. Diese wurden vor allem von Bernfeld, Reich, Simmel und Fenichel vorangetrieben, »bis deren Aktivitäten unter der Bedrohung und Verfolgung durch die Nazis vorläufig erstickt wurden« (S. 23). Die Überschriften der ersten Kapitel entsprechen diesem Ansatzpunkt: »Die Psychoanalyse muß die Gesellschaft herausfordern«, »Versuche, die Psychoanalyse mit dem Sozialismus zu verbinden«, »Zwei publizieren gegen Hitler – die anderen bleiben stumm« und »Zugeständnisse bis hin zur Selbstverleugnung«. Richter erinnert an die Bemühungen insbesondere in den 20er und 30er Jahren, die Psychoanalyse mit dem Marxismus zu verbinden. Manche kamen zur Psychoanalyse, weil diese ihnen als eine Ergänzung ihres sozialreformerischen Engagements erschien. In einer gewissen Weise teilte Freud dieses Engagement, was sich u. a. in seiner Unterstützung von zwei pazifistischen Manifesten zeigte, in denen die Abschaffung der Wehrpflicht gefordert wurde.
In »Zwei publizieren gegen Hitler- die anderen bleiben stumm« erinnert Richter an zwei Autoren, die es nicht bei eher allgemein bleibenden Bemühungen beließen, sondern die die Gefahr des heraufriehenden Faschismus sehr bewusst erkannten und öffentlich wissenschaftlich analysierten: Wilhelm Reich und Georg Simmel. Simmel, dessen Schriften seit einigen Jahren wieder allgemein zugänglich sind, veröffentlichte 1932 den mutigen sozialpsychologischen Aufsatz »Nationalsozialismus und Volksgesundheit«, in dem er schrieb:
»Die Hitler-Bewegung ist nun, psychologisch gesehen, eine Wiederherstellung des Kriegszustandes für ihre Anhänger. Es herrscht wieder absolute Befehlsgewalt des einen unverantwortlichen Führers, der allen anderen die Verantwortung und damit ihre Schuldgefühle abnimmt. Der Feind steht wieder außerhalb der Gemeinschaft. Diesmal ist es der Jude, der Marxist, der Andersdenkende – er ist das Ziel, in Wirklichkeit das Phantom für die Abreaktion aggressiver kannibalischer Strebungen.» (S. 33)
Solche Studien erregten innerhalb der psychoanalytischen Zunft bekanntlich keineswegs ungeteilte Freude. Sie stießen in Wien und Berlin vielmehr »teils auf betretenes Schweigen, teils auf heftige Ablehnung« (S. 36). Es kam zur Maßregelung Wilhelm Reichs, 1934 zum Ausschluss.
Für Richter stellt der »Präzedenzfall Reich« (S. 40) einen Wendepunkt in der Geschichte der Psychoanalyse dar, der zur Marginalisierung gesellschaftskritischer Bestrebungen führte, deren Folgewirkungen bis heute – wie Richter im Buch immer wieder herauszuarbeiten sucht – nachweisbar sind.
Die reale gesellschaftliche Gewalt wurde damals von der Majorität der Analytiker nicht »bearbeitet«, sondern mit einem Diskussionsverbot belegt, tabuisiert. Es kam zu einer Anpassung an den »Zeitgeist«, einer schleichenden Deformation des ehemals selbstkritischen Impetus. Richter betont:
«Man warf den Mann hinaus, der offen und unmißverständlich klarmachte, daß die Leitvorstellung einer durch Autoritätsgehorsam gleichgeschalteten »Volks- und Rassengemeinschaft dem Menschenbild der Psychoanalyse unversöhnlich gegenüberstand. (…) Nicht als einer, der eine gefährliche Wahrheit publiziert hatte, sondern als ein Abtrünniger wurde Reich eliminiert.« (S. 37f.) Dass dies keineswegs eine »historische« Diskussion ist, hat sich spätestens in den 8oerJahren gezeigt. Eine »offizielle« Entschuldigung für den Hinauswurf Reichs, eine Rehabilitation Wilhelm Reichs, habe es niemals gegeben (s. Fallend/Nitzschke 2002). In dem Kapitel «Willy Brandt, Wilhelm Reich und die Psychoanalyse« greift Richter dieses Thema erneut auf. Er schildert die Motive seines Engagements für Willy Brandt Anfang der 70er Jahre. Richter war beeindruckt von dessen Glaubwürdigkeit. Dieser berichtete ihm einmal, dass er als begeisterter Zuhörer an Wilhelm Reichs Seminaren während ihrer gemeinsamen Emigrationszeit in Oslo teilgenommen habe. Dessen psychoanalytischen Deutungen des Faschismus erschien Brandt als hochinteressant und überzeugend. Richter schildert nun eine Szene, die seinen Versuch, Spuren der progressiven Ursprünge der Psychoanalyse auch noch in der Gegenwart glaubwürdig wirksam werden zu lassen, konkretisiert:
»Daß er übrigens, noch als Kanzler, nach einem sonntäglichen Telefongespräch die schon gestrichenen Gelder für die Psychiatrie-Reform Finanzminister Matthöfer doch noch abgerungen hat, sei nur nebenbei erwähnt. So war Wilhelm Reich als eine Art Katalysator am Ende doch noch indirekt an einer sinnvollen gesundheitspolitischen Initiative in dem Land beteiligt, das ihn vertrieben hatte. Es dürfte in seinem Sinne gewesen sein.« (S. 174)
Zurück zum chronologischen Aufbau des Buches. Richter erinnert an das von Simmel organisierte Antisemitismus-Symposium 1944 in San Francisco, wo einige vertriebene Psychoanalytiker und Soziologen inmitten des Krieges noch einmal klarsichtige Analysen des Antisemitismus vortrugen. Diese kulturkritische Tradition der Psychoanalyse trat jedoch innerhalb der analytischen Standesorganisationen immer mehr in den Hintergrund (s. Fisher 2003). Unter Bezugnahme insbesondere auf die Erfahrungen der Emigranten Bruno Bettelheim, Ernst Federn und Rudolf Ekstein (s. Federn 1999, Kaufhold 2001) mit der Psychoanalyse sowie der Psychoanalytischen Pädagogik in den USA zeichnet er in »Amerikanische Mißverständnisse», »Die Medizinalisierung der Psychoanalyse» sowie »Der Untergang des Gründergeistes» sehr eingängig und überzeugend den weiteren historischen Prozess der Etablierung, aber eben auch der gesellschaftskritischen Entsagung der Psychoanalyse in Deutschland und den USA nach. Richter betont:
»Die Geschichte kennt unzählige Beispiele dafür, daß revolutionäre geistige Bewegungen nicht nur erlahmen oder erstarren, sondern schließlich Züge annehmen, die ihren ursprünglichen oder vielleicht sogar nach wie vor verkündeten Absichten zuwiderlaufen. Das führt zu Identitätskrisen, deren Verarbeitung um so weniger zu gelingen pflegt, je hartnäckiger sie verleugnet werden. Die Psychoanalyse ist in eine solche Krise hineingeraten, vorbereitet durch das Zusammenwirken äußerer Verfolgung und innerer Anpassung. Die Medizinalisierung war nur ein Symptom, nicht die Ursache der Veränderung. Die Analytiker wurden braver, sie suchten für ihre Institute bravere Kandidaten aus. Leidenschaftlich engagierte junge Leute vom Schlage eines Siegfried Bernfeld oder eines Wilhelm Reich hätte man nach dem Kriege sicher nicht mehr aufgenommen.« (S. 77)
In diesem Sinne stellt Richter bereits im Vorwort seines Buches ernüchtert fest: »Viele Kollegen wünschen es eben nicht, außer der Auseinandersetzung mit Kostenträgern und Berufsverbänden jemals wieder in politische Konflikte verwickelt zu werden» (S. 13). Und: »Von einer psychoanalytischen Bewegung kann man jedenfalls schwerlich noch sprechen» (5. 10).
In einigen weiteren Kapiteln, etwa in »Eigene Suche nach Orientierung«, zeichnet Richter die Entwicklung der Psychoanalyse in der Bundesrepublik der Nachkriegsperiode nach, wie er sie selbst erlebt hat. Danach folgen drei Kapitel über die »Wiedergeburt einer politischen Psychoanalyse«. Richter porträtiert in knappen Zügen das Leben und Werk von Alexander Mitscherlich, Marie Langer und insbesondere Paul Parin sowie Goldy Parin-Matthey, welche er als ermutigende Gegenkräfte gegen die beschriebene Entpolitisierung der Psychoanalyse erlebt hat. So wie Bernfeld, Fenichel, Simmel und Reich, aber auch Bettelheim, Federn und Ekstein für Horst-Eberhard Richter historisch bedeutsame Persönlichkeiten sind, die die kulturkritische Substanz der Psychoanalyse sowie der Psychoanalytischen Pädagogik mitformuliert und authentisch gelebt haben, so repräsentieren Mitscherlich, Langer sowie die Parins für ihn den emanzipatorischen »Gründergeist« der Psychoanalyse. Richter hebt hervor: »Alle vier hatten inmitten von Nazi- und faschistischem Terror die Fähigkeit bewiesen, sich durch Anpassungsverweigerung vor der Wehrlosigkeit gegenüber den unbewußten Anpassungsmechanismen zu bewahren.« (S. 13) Und im Kapitel »Unterschätzte Anpassungsmechanismen«, Parins (s. Parin/Parin-Matthèy 2000) Studien entlehnt, hebt Richter hervor:
»Mir imponierten sie durch ihre besondere politische Standhaftigkeit, die ich in einem engen Zusammenhang mit einigen ihrer wichtigsten psychoanalytischen Fragestellungen sehe. (…) Selbst Widerständler bzw. Widerständlerin inmitten von Ohnmacht und Anpassung, waren sie dafür prädestiniert, den großen Problemkreis des unbewußten Konformismus zu bearbeiten.» (S. 141)
Für mich ansprechend ist Horst-Eberhard Richters Offenheit und Ehrlichkeit. Er beschreibt seinen eigenen Entwicklungsprozess, seine Suche nach einer sozialpolitischen Identität, die ihm, wie er im Buch verschiedentlich durchschimmern lässt (S. 13, S. 199), Feindschaft, Ächtung durch seine privilegierte Standesorganisation einbrachte. So bemerkt Richter im Porträt Mitscherlichs: »Was mich selbst von Mitscherlich trennte, war damals vor allem der Abstand zu seinem gewaltigen Mut, sich nahezu pausenlos mit großen Teilen der Ärztezunft und den konservativen Medien anzulegen. Es sah manchmal so aus, als bereiteten ihm die vielen Schlachten mit seinen Widersachern so etwas wie Genugtuung. Daß ich je bereit sein würde, mir ähnliche Feindschaften zuzuziehen, erschien mir vor dreißig Jahren noch als absolut unvorstellbar.» (S. 125)
In der zweiten Hälfte des Buches beschreibt Richter einige exemplarische gesellschaftliche Felder sowie sozialpolitische Streitthemen, in die er selbst handelnd und gestaltend involviert war.
Historischer Ausgangspunkt für die sich schrittweise verändernden gesellschaftlichen Diskussionen sind für Richter die Jahre der Studentenbewegung. Dementsprechend leitet er diesen Themenbereich mit dem Aufsatz »Der Beziehungskonflikt zwischen den Antiautoritären und der Psychoanalyse» ein. Richter befand sich damals beruflich in einer »Zwischenposition«. Er war der Studentengeneration entwachsen, hatte in Gießen Führungspositionen erlangt, vermochte jedoch innerlich noch eine Beziehung zur rebellierenden Generation herzustellen. Er erkannte rasch, dass das Thema der historisch gewachsenen Schuld an den »unbearbeiteten» Verbrechen der Nazis einen wesentlichen Motor für die seinerzeit scheinbar eruptiv aufbrechenden gesellschaftlichen Diskussionen darstellte. Um so enttäuschter war er, dass gerade die psychoanalytische Standeszunft, die sich eine methodisch betriebene Selbstreflexion als Spezifikum ihrer Profession auf ihre Fahnen zu schreiben berechtigt fühlt, sich betont distanziert gegenüber den gesellschaftlichen Veränderungswünschen verhielt: »Es waren Erfahrungen, die meinen schrittweisen Rückzug aus aktiver Mitarbeit in Funktionen der Vereinigung einleiteten« (S. 160f.). Nach seiner Erinnerung gelang es ihm und analytischen Kollegen in Gießen (s. Wirth 2002), die aufbrechende Kritik nicht nur als bedrohlichen Angriff, sondern als wachrüttelnde Anregung zur Bearbeitung eigener verdrängter Anteile zu nutzen. Das Einmünden eines Teils der kurzzeitigen revolutionären Stimmung in soziale Reformprojekte war ganz in Richters Sinne: »Als die Bewegung allmählich mehr und mehr ihren ideologischen Fundamentalismus und ihren revolutionären Allmachtsanspruch verlor, sich statt dessen konkreten Erneuerungsvorhaben zuwandte, gewann ich vollends Anschluß an solche Initiativen. Dabei glaubte ich zu erkennen, daß in den sozialen Projekten, in denen ich mit Enthusiasmus mitwirkte, auch ein sinnvoller Teil von Erinnerungsarbeit geleistet werden konnte.» (S. 161)
Die konkrete Ausformung dieser Arbeit mittels des »introspektiven Konzeptes« (5. 162) beschreibt Richter anhand seiner knapp zehnjährigen Arbeit in einer Obdachlosensiedlung, seiner Arbeit in der Friedens- und Ökologiebewegung sowie seiner Begegnung mit einem ehemaligen führenden Rechtsextremisten.
Die existentielle Bedeutung der menschlichen Destruktivität erwies sich für Richter hierbei als zentrale Bestimmungsgröße. Aus psychoanalytischer Sicht betont er immer wieder in Varianten: »Soziale Destruktivität kommt nicht erst von fremden Mächten, schlimmen Politikern oder falschen Ideologien, sondern noch zuvor aus uns selbst. Also steckt sie auch in denen, die sie untersuchen. Destruktivität läßt sich nicht wegschaffen, nur besserer Kontrolle unterwerfen. Sie kann um so weniger Unheil anrichten, je wachsamer man ihr nachspürt und sich mit ihr zuallererst in den eigenen sozialen Zusammenhängen kritisch auseinandersetzt.» (5. 17)
Dies könnte auch als Motto über diesem Buch stehen.
Mein bleibender Eindruck von dieser Studie Horst-Eberhard Richters ist: Frei von moralisierendem Unterton erinnert uns dieser »liebenswürdige und zurückhaltende Mensch« mit seinem »illusionslose(m) Blick und seine(r) nie versagende(n) Hoffnung« (Paul Parin, 1991) daran, was die Psychoanalyse sowie die Psychoanalytische Pädagogik einmal waren und was sie immer noch bewirken könnten – sofern die gesellschaftlichen Verhältnisse dies zulassen und wir dies wirklich wollen.
Horst-Eberhard Richter, Psychoanalyse und Politik. Zur Geschichte der politischen Psychoanalyse, edition psychosozial, Psychosozial-Verlag, 332 S., Euro 22,90, Bestellen?
Diese Rezension erschien zuerst in: Psychoanalytische Familientherapie 7/2003