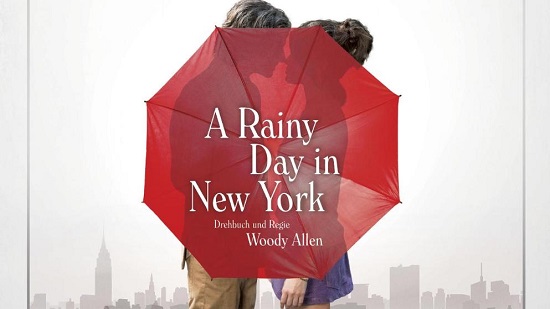Woody Allens neue Komödie „A Rainy Day in New York“…
Von Miriam N. Reinhard
Es soll ein romantisches, unvergessliches Wochenende werden und der junge Collegestudent Gatsby Welles (Timothée Chalamet), der aus einer wohlhabenden jüdischen New Yorker Familie stammt, alte Filme, schummrige Bars und das Glücksspiel liebt, der ein Zocker, Melancholiker und Romantiker ist, hat alles ganz genau geplant, um diesen Anspruch zu erfüllen; denn schließlich will er seiner Freundin Ashleigh (Elle Fanning), einer etwas weltfremden Bankierstochter aus Arizona, mal die große Stadt zeigen – New York. Es trifft sich gut, dass sie dienstlich dort zu tun hat. Für das College-Magazin soll sie den Regisseur Roland Pollard (Liev Schreiber) interviewen.
Woody Allens neue Komödie „A Rainy Day in New York“ erzählt von einem Wochenende, an dem alles schief geht, sich dann alles zum Guten wendet und vor allem davon, was man zu sehen bekommen kann, wenn man einen Blick hinter Kulissen riskiert.
Ashleigh trifft Regisseur Roland Pollard in verzweifelter Lage an. Er ist mit seinem neuen Film überhaupt nicht zufrieden; die so blonde wie naive Ashleigh versichert ihm, ein ganz großer Regisseur zu sein. Pollard möchte ihr deshalb ein „besonderes Bonbon“ für ihr Interview bieten; Ashleigh fragt ahnungslos: „Schoko?“ Aber nein, es ist kein Bonbon zum Essen. Pollard bietet ihr eine Preview seines neuen Films an, den er am liebsten einstampfen will. Bei der Preview, die Pollard wütend über die „dampfende Existenzialistenscheiße“ verlässt, um sich frustriert zu betrinken und dem Selbsthass hinzugeben, trifft Ashleigh auf den nächsten Mann der Branche, den Drehbuchautor Ted Davidoff (Jude Law). Als Pollard verschwunden ist, beschließen die beiden, nach ihm zu suchen; so kommt Ashleigh schließlich allein im Filmstudio an, in dem Pollard vermutet wird. Hier findet sie ihn zwar nicht, aber läuft dafür direkt dem dritten Mann in die Arme, dem Schauspieler Francisco Vega (Diego Luna), der – so versichert sie ihm – „die beste Erfindung seit der Pille danach“ sei. Vega, smart, charismatisch, seinerseits nicht sonderlich helle, ist geschmeichelt von der schönen Ashleigh und sieht eine Chance, sie zu verführen, doch er nimmt sie zunächst zu einer Party mit. Auf der Party trifft sie Regisseur und Drehbuchautor wieder – beide Männer versichern der immer betrunkener werdenden Ashleigh, ihre Muse, die Wende in ihrem Leben zu sein.
Nun kann man diese Hauptfigur Ashleigh unter feministischer Perspektive kritisch betrachten, und Teile der Kritik sind bemüht zu sagen, dass sie mindestens problematisch, wenn nicht gar frauenfeindlich sei. Doch man kann sie auch anders deuten: Denn Muse-Werden ist schließlich ein performativer Akt. Wenn ein 21-jähriges Dummchen (Fanning spielt diese Rolle so brillant, dass man nicht eine Sekunde an der bodenlosen Dummheit Ashleighs zweifeln kann) von diesen in der Branche gestandenen Männern zur Muse ernannt wird, dann spiegelt das auch das Niveau dieser Männer zurück. Wenn eine Frau, die nicht mal simple Metaphern zu decodieren vermag, plötzlich einen Film retten oder eine Lebenskrise lösen kann – wie ist es dann eigentlich um die Qualität dieses Films und die existentielle Dimension der Krise bestellt? Von den drei Männern, denen Ashleigh begegnet, ist Francisco Vega der einzige, der ganz platt darauf aus ist, mit ihr im Bett zu landen – denn er besitzt nicht mal genug Hirn, um zu suggerieren, dass er nicht oberflächlich ist. Die anderen beiden Männer scheinen sich von dem ahnungslosen Mädchen allerdings wirklich Antworten zu erhoffen – und das lässt doch sehr tief blicken, was den Anspruch ihrer Fragen angeht.
Die Deutung des Films als frauenfeindlich funktioniert auch deswegen nicht, weil die Frauenfigur der Ashleigh durch weitere Frauen kontrastiert wird, mit denen Gatsby sich in der weiteren Handlung konfrontiert sehen muss.
Während Ashleigh einen bezeichnenden Blick hinter die Kulissen der Filmbranche gewährt bekommt, ist Gatsby, der zunehmend frustriert über die Durchkreuzung seiner Pläne durch New York latscht „wie Hagar durch die verdammte Wüste“, seinerseits in einen Film gestolpert: Ein alter Schulfreund dreht einen Studentenfilm und braucht noch einen Statisten für eine Kussszene; und so küsst Gatsby eine alte Bekannte: die Designstudentin Chan (Selena Gomez), die die kleine Schwester seiner Exfreundin aus Schulzeiten ist. Jetzt ist sie gar nicht mehr so klein und ihm auch intellektuell mindestens gewachsen, wenn nicht sogar überlegen.
Hier ist es dann eine Frau, die Regie zu führen beginnt, die die Kussszene so dirigiert, wie sie sie haben will und das Ganze zudem mit ironischer Distanz betrachtet. Nach dem Filmdreh begleitet Gatsby Chan ins Museum, wo – wie so oft in Allens Filmen – der nächste Zufalls-Treffer geschieht: Gatsby läuft seiner Tante und seinem Onkel vor die Füße und damit ist klar: Seine Familie weiß nun, dass er sich in New York aufhält, er wird die Party seiner Mutter besuchen müssen, ein „Potpourri aus blasierten Wohlstandsspießern.“ Weil Ashleigh ihn sowieso versetzt hat, er sich seiner Mutter aber nun mit Freundin und Krawatte zur Party präsentieren muss, engagiert er die Edelnutte Terry (Kelly Rohrbach), um ihn zu dieser Party als seine Freundin zu begleiten. Im großbürgerlichen Elternhaus angekommen, wartet die nächste Überraschung auf ihn: Seine Mutter (Cherry Jones) bittet Terry, das Haus zu verlassen und konfrontiert ihren Sohn damit, eine Prostituierte mitgebracht zu haben. Sie würde solche Frauen erkennen, denn sie stamme selbst aus dem Milieu, habe so Gatsbys Vater kennengelernt.
Der ganze bildungsbürgerliche, überkandidelte Upperclass-Habitus der Mutter – alles nur Kulisse? Ja und Nein. Mrs. Welles sagt zu ihrem Sohn: „Sollte ich übers Ziel hinausgeschossen sein, in meinem Streben nach den höheren Dingen und der Pflege eines Images, und sollte ich dir damit Unbehagen bereitet haben, dann war das nur der Versuch einer übereifrigen Exnutte aus dem mittleren Westen, Erinnerungen zu löschen an die Widerwärtigkeiten der vielen Hotelzimmer, die mich schreiend immer noch aus dem Schlaf reißen.“
Gatsbys Mutter weiß, dass sich Authentizität und Inszenierung nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ihr Upperclass-Leben ist von ihr bewusst inszeniert – und damit ist es authentisch, es ist ihr Umgang mit ihrer Geschichte, es ist ihre Entscheidung, ihr Leben und ihre Regie. Gatsbys Mutter hat ein Bewusstsein davon, dass die gesellschaftlichen Kulissen, in denen sie sich bewegt, Kulissen sind, sie hat sie selbst gestaltet, sie füllt sie bewusst aus – und sie weiß, was sich hinter ihnen befinden kann. Doch ob hinter den Kulissen der Profi-Inszenierer des Filmbetriebes noch irgendetwas Anderes mit Substanz zu finden ist, ob dort nicht nur dieselben Pappfiguren stehen, die auf der Bühne präsentiert werden – das darf bezweifelt werden. Die ach so großen und bewundernswerten Männer, denen Ashleigh begegnet, sitzen narzisstisch der klischeehaften Dramatik ihrer gesellschaftlichen Rollen auf, die sie längst selbst nicht mehr durchschauen, dabei sollten doch gerade sie zur Reflexion darüber befähigt sein.
Dass Gatsby schließlich Ashleigh verlässt und sich auf Chan einlässt, sie vor der Delacorte Uhr im Central Park küsst, ganz so, wie sie sich immer ein romantisches Filmende vorgestellt hat, gibt der starken Frau endgültig die Regie in die Hand.
Wenn der Film über seine witzig-unterhaltsamen Momente hinaus eine Botschaft hat, dann vielleicht diese: Tiefe zeigt sich, wenn man mit den vielfältigen Inszenierungen der Wirklichkeit umzugehen lernt; an ihnen kann man wachsen, wie der altkluge Gatsby, der ein „großer Gatsby“ erst noch werden muss.
Diese Inszenierungen kann man selbst mitgestalten, kann in ihnen die Handlungsfreiheit und Regie behalten, wenn man auch hin und wieder die Bereitschaft zeigen sollte, das eigene Drehbuch geöffnet zu lassen, ohne dass man dann den Überblick über die eigene Geschichte verliert: wie Mrs. Welles, wie Chan.
Wie Woody Allen mit seinem neuen Film.